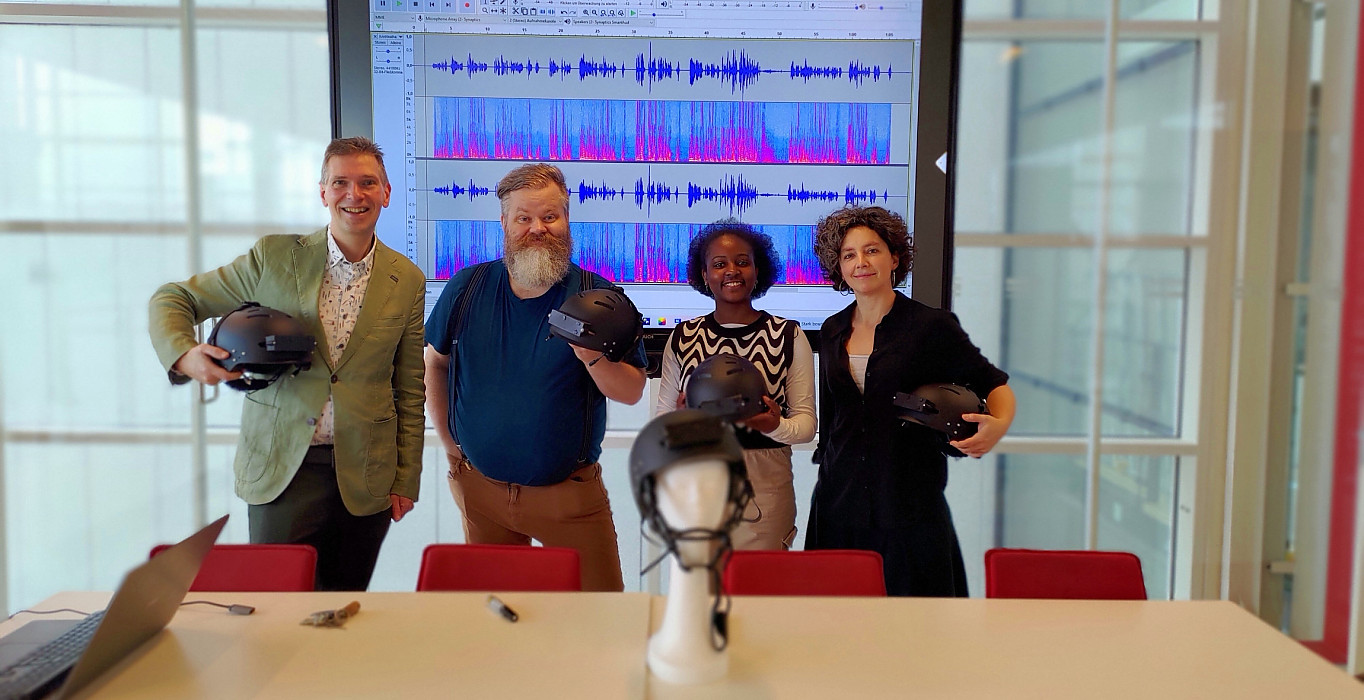Nach einer aktuellen Untersuchung empfinden viele Erwerbstätige digitalen Stress – etwa durch ständige Erreichbarkeit und Erwartungsdruck. Wie lässt sich dem vorbeugen?
Digitaler Stress entsteht nicht, weil Menschen sich schlecht organisieren. Er entsteht, weil Strukturen, Prozesse und Kulturen fehlen, die gesunde Grenzen ermöglichen. Besonders dort, wo Arbeitsleistung stark mit sichtbarem persönlichem Einsatz verbunden wird, ist das Risiko gross, dass Erreichbarkeit zur Norm wird – selbst am Abend oder am Wochenende.
Vorbeugung beginnt bei der Führung. Wer Verantwortung trägt, muss den Mut haben, bewusst Räume für Erholung zu schaffen. Dazu gehören klare Regeln zur Erreichbarkeit, eine realistische E-Mail- und Meetingkultur sowie die Vorbildfunktion von Vorgesetzten. Wir sehen immer wieder: Mitarbeitende orientieren sich daran, was ihre Chefin oder ihr Chef vorlebt. Wer nachts oder am Wochenende Mails schreibt, sendet ein klares Signal – auch ohne Worte.
Gleichzeitig lohnt es sich, gezielt in die digitale Kompetenz der Mitarbeitenden zu investieren. Der bewusste Umgang mit digitalen Tools, Pausen, Benachrichtigungen und dem eigenen digitalen Rhythmus muss gelernt werden – und verdient Anerkennung. Digitaler Stress ist kein individuelles Problem, sondern Ausdruck systemischer Versäumnisse – und damit gestaltbar.
Als Problem wird auch die mangelnde Benutzerfreundlichkeit digitaler Tools empfunden – was lässt sich dagegen unternehmen?
Technologie sollte helfen – nicht belasten. Doch viele erleben das Gegenteil: Systeme, die zu komplex sind, Prozesse, die nicht durchdacht wirken, Schnittstellen, die fehlen. Gerade in Organisationen mit hoher Verantwortung wird schlechte Usability schnell zum Stressfaktor.
Deshalb plädiere ich für eine Art „digitale Ergonomie“. Wie wir auf gute Stühle und Beleuchtung achten, sollten wir auch benutzerfreundliche Software zur Pflicht machen. Mitarbeitende müssen die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen einzubringen – idealerweise schon vor der Einführung neuer Tools. Was auf dem Papier überzeugt, kann im Alltag unpraktisch sein.
Zudem braucht es Zeit: für Schulungen, für Begleitung, für Menschen, die weiterhelfen, wenn es hakt. ‚Plug & Play‘ funktioniert selten wirklich. Wenn Tools intuitiv sind, Prozesse klar strukturiert, und die Mitarbeitenden sich ernst genommen fühlen, dann kann Technologie tatsächlich entlasten.
Welche zusätzlichen Stresspotenziale sehen Sie durch neue KI-Anwendungen kommen – oder wie kann KI vielleicht helfen, digitalen Stress zu vermindern?
KI ist gekommen, um zu bleiben – auch in der Schweiz. Viele spüren dabei ein Unbehagen: „Werde ich ersetzt?“ „Kann ich das noch verstehen?“ „Wer kontrolliert das?“ Diese Unsicherheiten sind berechtigt – und verdienen ernsthafte Antworten. Denn wo Intransparenz herrscht, wächst der Stress.
Gleichzeitig eröffnet KI enorme Chancen, gerade wenn sie menschliche Fähigkeiten ergänzt statt verdrängt. Richtig eingesetzt, kann sie Routinearbeiten abnehmen, Dokumentationen automatisieren oder Informationen filtern. In der Langzeitpflege etwa könnten KI-gestützte Tools den administrativen Aufwand reduzieren – und damit Freiraum schaffen für das Wesentliche: zwischenmenschliche Nähe.
Doch: Die Einführung muss professionell begleitet werden. Mitarbeitende müssen verstehen, wie KI funktioniert, was sie leistet – und wo ihre Grenzen liegen. Schulung, ethische Reflexion und Mitbestimmung sind dabei unerlässlich. Nur wenn wir den Menschen mitnehmen, hilft KI, statt zusätzlichen Stress zu verursachen.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sollte die Politik aus Ihrer Sicht gegen digitalen Stress am Arbeitsplatz schaffen?
Rechtliche Vorgaben ersetzen keine gute Unternehmenskultur. Sie schaffen jedoch verbindliche Rahmenbedingungen und bieten Orientierung, wo freiwillige Massnahmen bislang nicht ausreichen. Ein gesetzlich verankertes ‚Recht auf Unerreichbarkeit‘, wie es in Frankreich existiert, ist ein starkes Signal für gesunde Arbeitsgrenzen. Auch in der Schweiz wäre es sinnvoll, diesen Diskurs weiterzuführen und zu prüfen, wie rechtliche Regelungen zur Eindämmung von Entgrenzung gestaltet werden könnten – mit Augenmass und ohne die betriebliche Flexibilität unnötig einzuschränken.
Im Zentrum sollte ein klarer Präventionsansatz stehen: Es braucht gezielte Förderungen zur Stärkung der digitalen Kompetenz in Betrieben, konkrete Anforderungen an die digitale Ergonomie von Arbeitsmitteln – insbesondere bezüglich Barrierefreiheit und Gebrauchstauglichkeit – sowie verbindliche Leitlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI. Solche Rahmenbedingungen fördern die Gesundheit der Arbeitnehmenden und stärken zugleich die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Die Schweiz lebt von Eigenverantwortung – politisch wie unternehmerisch. Diese Verantwortung sollten wir auch im digitalen Wandel konsequent wahrnehmen.