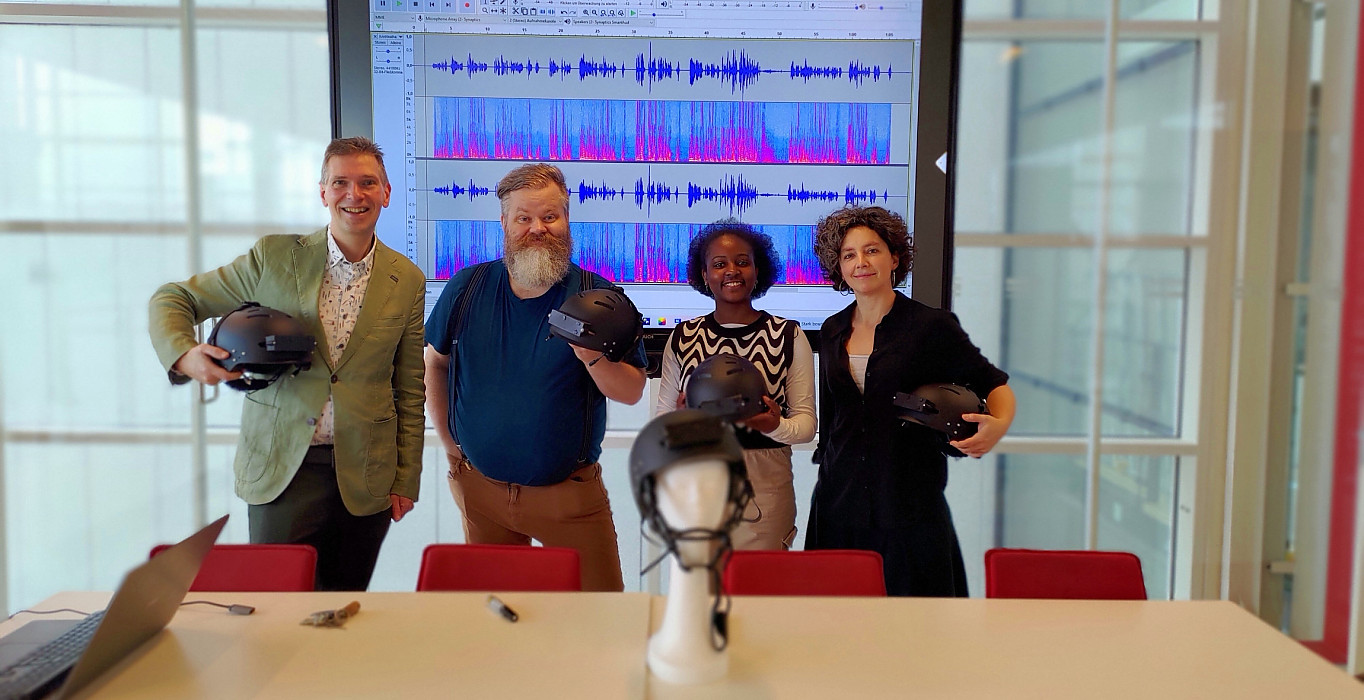Nach einer aktuellen Untersuchung empfinden viele Erwerbstätige digitalen Stress - etwa durch ständige Erreichbarkeit und Erwartungsdruck. Wie lässt sich dem vorbeugen?
Durch ständige Erreichbarkeit wird das Abschalten von der Arbeit erschwert und damit Erholung verhindert, Gesundheit gefährdet und Leistungsfähigkeit verringert. Digitale Technologien, insbesondere Smartphones, ermöglichen Erreichbarkeit auch außerhalb der Arbeitszeit – telefonisch, per Chat, E-Mail etc. Dabei ist die Erreichbarkeit oft nicht funktional, d.h. für die Erfüllung von Arbeitsaufgaben notwendig (wie bspw. bei Wartungsservices), sondern beruht auf informellen Erwartungen. Diese sog. Erreichbarkeitskulturen sind damit ein wichtiger Ansatzpunkt.
Führungskräften fällt hier einerseits die Vorbildrolle zu, d.h. sie sollten sich selbst und ihre Mitarbeitenden abgrenzen. Dazu gehören keine unnötigen Anrufe nach Feierabend, kein Versand von E-Mails am Wochenende, und kein Posten von Nachrichten im Chat. Zudem sollten sie auf nicht zeitkritische Nachrichten und E-Mails auch nicht außerhalb der Arbeitszeit reagieren. Den Mitarbeitenden fällt es dann leichter, sich auch selbst solchermaßen abzugrenzen.
Andererseits sind Führungskräfte auch verantwortlich für aktive Veränderungen. Da hinter Erreichbarkeitskulturen oft unausgesprochene Erwartungen stehen, wie implizite Loyalitätstests, kann eine Klärung dieser gegenseitigen Erwartungen (und von Notwendigkeiten für Erreichbarkeit) im Team helfen. Durch die Reflektion dieser Erwartungen kann man sich auf Regeln für Nicht-Erreichbarkeit einigen, so dass keine Schuldgefühle oder Ängste ausgelöst werden, wenn man außerhalb der Arbeitszeit nicht reagiert. Zudem kann die eigene Gedankenlosigkeit beim Absenden von Nachrichten durch Rücksichtnahme auf andere verändert werden. Oft reicht ein Thematisieren der impliziten Erreichbarkeitserwartungen aus; manchmal bieten sich ggf. Teamworkshops oder -coachings an, um digitalen Stress zu reduzieren. Insbesondere wenn Mitarbeitende regelmäßig im Homeoffice arbeiten sind Führungskräfte zusätzlich gefordert, und eine Klärung im Team ist hilfreich.
Auch innerhalb der Arbeitszeit können verschiedene Maßnahmen helfen, digitalen Stress zu verringern: Bestimmte Arbeitszeiten für E-Mails oder Telefonate zu reservieren, einvernehmlich störungsfreie Zeiten zu vereinbaren, oder Informationsaustausche zu strukturieren sind hier Möglichkeiten. Für Mitarbeitende kann es zudem sinnvoll sein, digitale Arbeits- und Privatgeräte zu trennen, das Smartphone außer Sichtweite zu legen, Push-Nachrichten auf dem Smartphone zu unterbinden, und v.a. den Ton für Benachrichtigungen auszustellen. Da der Ton schnell zu Konditionierung führt, sind Unterbrechungen und digitaler Stress vorprogrammiert. Auch die Mitgliedschaft in Gruppenchats sollte kritisch hinterfragt werden.
Als Problem wird auch die mangelnde Benutzerfreundlichkeit digitaler Tools empfunden – was lässt sich dagegen unternehmen?
Digitale Tools erfordern ein bestimmtes Verständnis der Bedienoberfläche, Möglichkeiten und Grenzen der Anwendungen. Es kommen nicht nur regelmäßig neue Tools hinzu, die bestehenden werden auch fortlaufend weiterentwickelt. Dies kann zu Überforderung führen, da Routinen nur begrenzt einsetzbar sind, ein ständiges Lernen erforderlich ist, und ggf. die eigenen Fähigkeiten für die Bedienung angezweifelt werden.
Unternehmen können bestimmte Tools auswählen, die vorzugsweise verwendet werden sollten, und dafür Anleitungen zur Bedienung bereitstellen (oder auf vorhandene Anleitungen hinweisen; entsprechende Videos finden sich oft im Internet). Im Team könnte man entweder Tandems bilden, die sich regelmäßig gemeinsam Neuerungen aneignen, neue Tools oder Funktionen als TOP im Teammeeting aufnehmen und vorstellen, oder auch andere Formen des gemeinsamen Lernens fördern. Soziale Unterstützung kann hier auch bei Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten oder Motivationsproblemen helfen.
Welche zusätzlichen Stress-Potenziale sehen Sie durch neue KI-Anwendungen kommen – oder wie kann KI vielleicht helfen, digitalen Stress zu vermindern?
Einerseits bergen neue KI-Anwendungen viel Potenzial für digitalen Stress. Intransparenz verunsichert Mitarbeitende in Bezug auf Datenschutz; die Monetarisierung von Informationen in Kombination mit der Monopolstellung großer Digitalplattformen trägt nicht zur Vertrauensbildung bei. Auch befürchteter Kontrollverlust durch Verselbständigung von KI und die mangelnde Einschätzbarkeit von Resultaten insbesondere in Bezug auf die sog. KI-Halluzinationen sind belastend. Zudem können Fähigkeiten verloren gehen, wenn KI zukünftig noch mehr elementare Denkaufgaben abnimmt. Im schlimmsten Fall werden Arbeitsplätze überflüssig, wobei dies v.a. Unqualifizierte trifft.
Andererseits können KI auch die Arbeit erleichtern und beschleunigen (was z.B. eine strukturelle Arbeitszeitreduktion ermöglichen würde), Routineaufgaben abnehmen und damit mehr Zeit für übergeordnete Denkarbeit fördern, und neuartige Impulse und kreative Lösungen liefern. Die Analyse großer Datenmengen durch KI kann Erkenntnisse generieren, die Menschen so nicht möglich sind. Letztlich könnten neue Aufgaben und ggf. sogar Berufe entstehen durch die Zusammenarbeit mit KI.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sollte die Politik aus Ihrer Sicht gegen digitalen Stress am Arbeitsplatz schaffen?
Auf politischer Ebene sollten Aktivitäten zur echten Arbeitszeitreduktion bei gleichbleibendem Gehalt ermöglicht werden (z.B. 4-Tage-Woche). Ein Recht auf Nichterreichbarkeit sowie ein kritisches Hinterfragen rechtlicher Flexibilisierung, z.B. der täglichen Arbeitszeit, wären ebenfalls angezeigt.
Politisch sollten Datenschutzrichtlinien und Verbraucherfreundlichkeit, v.a. aber Einschränkung der Monopolstellung und der Monetarisierung von Informationen auf der Agenda stehen. So darf es keine Frage des Geldbeutels sein, ob man sich gegen Identitätsdiebstahl und Deep Fake wehren kann.