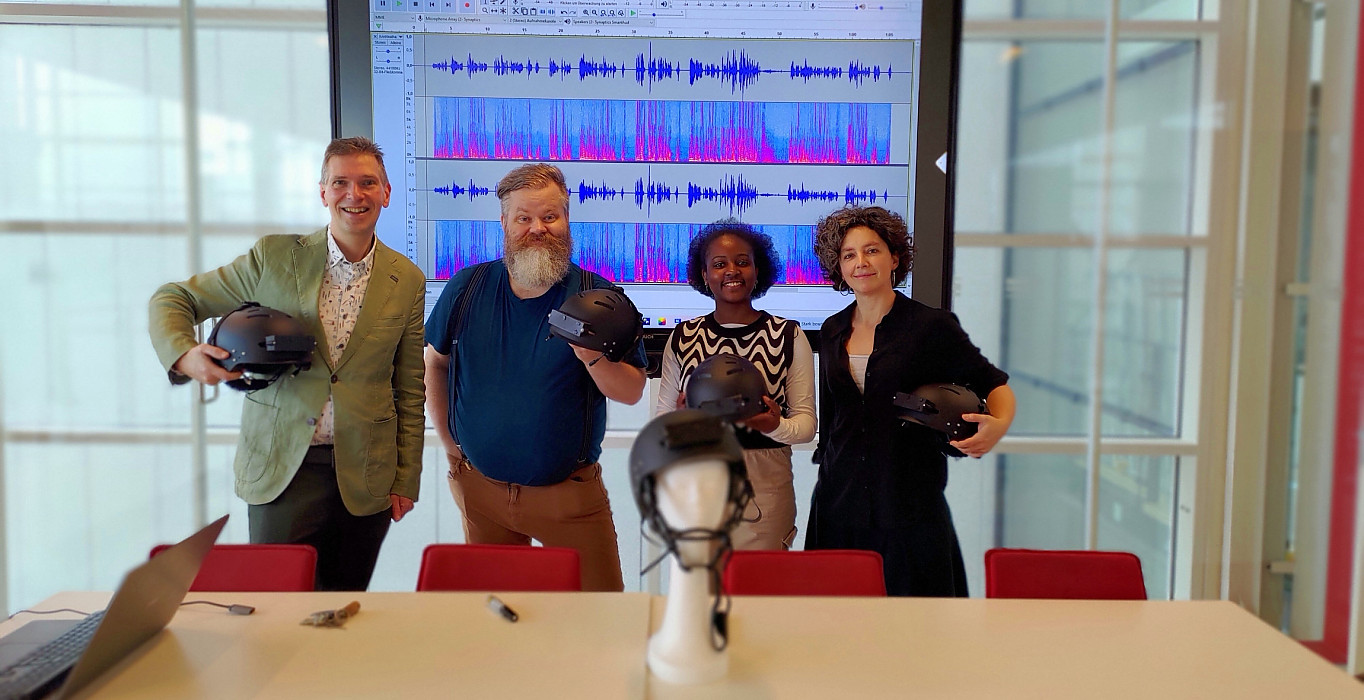Nach einer aktuellen Untersuchung empfinden viele Erwerbstätige digitalen Stress – etwa durch ständige Erreichbarkeit und Erwartungsdruck. Wie lässt sich dem vorbeugen?
Digitaler Stress – insbesondere durch ständige Erreichbarkeit – ist kein neues Phänomen. Bereits vor der Pandemie zeichnete sich eine zunehmende Erwartungshaltung des „Always-on“-Seins ab*. Einhergehend mit der Flexibilisierung der Arbeit und insbesondere der eingeforderten Autonomie, was die Wahl des Arbeitsortes und der Arbeitszeit angeht**, steigt die gefühlte Verpflichtung erreichbar zu sein, flexibel und das nicht nur nine to five.
Heute ist es vielerorts zur Norm geworden, digitale Nachrichten innerhalb weniger Minuten zu beantworten – unabhängig davon, welches Kommunikationstool gerade genutzt wird. Parallel dazu ist die Anzahl digitaler Kanäle exponentiell gestiegen: E-Mails, Messenger-Dienste, Foren und Push-Benachrichtigungen haben den Informationsfluss massiv erhöht. Technostress bezeichnet die stressauslösenden Aspekte der Nutzung digitaler Technologien, insbesondere die permanente Informationsflut, die ständige Erreichbarkeit sowie die häufigen Unterbrechungen durch digitale Kommunikationsmittel. Diese Faktoren können kognitive Überlastung, Kontrollverlust und Erschöpfung hervorrufen und die Arbeitsleistung sowie das Wohlbefinden beeinträchtigen***. Das ist die aktuelle Realität – und eine kurzfristige Umkehr ist nicht zu erwarten.
Wer sollte Verantwortung übernehmen?
1. Unternehmen und Führungskräfte müssen konkrete Maßnahmen zur Reduktion digitalen Stresses definieren und kommunizieren. Klare Regeln zur Erreichbarkeit – z. B. keine E-Mails außerhalb definierter Arbeitszeiten – sind essenziell. Digitale Tools können hierbei sogar unterstützen: etwa durch Funktionen, die den Versand zeitlich begrenzen. Mitarbeitenden muss bewusst ermöglicht werden, „abzuschalten“ – z.B. durch die gezielte Deaktivierung von Benachrichtigungen. Führungskräfte tragen hierbei eine wichtige Vorbildfunktion. Wer am Wochenende oder in der Nacht E-Mails schreibt, sendet ein klares Signal – ob gewollt oder nicht. Eine achtsame Unternehmenskultur im Umgang mit digitalen Tools muss nicht nur propagiert, sondern vor allem auch gelebt werden.
2. Mitarbeitende selbst sind ebenfalls gefordert, ihre Grenzen zu definieren und einzufordern. Das erfordert ein hohes Mass an Selbstreflektion und Selbstmanagement. Was brauche ich? Was tut mir gut? Woran merke ich, dass ich überfordert bin? Neben der Innenschau und dem Fokus auf sich selbst braucht es jedoch noch etwas. In einer zunehmend individualisierten Arbeitswelt bedeutet Flexibilität zwar Freiheit – etwa um am Abend E-Mails nachzuholen, wenn tagsüber Kinderbetreuung anstand – kann aber ungewollt Stress bei Kolleginnen und Kollegen auslösen. Der bewusste Umgang mit digitalen Kommunikationszeiten ist daher auch eine Frage der gegenseitigen Rücksichtnahme.
3. Auch der Staat kann und sollte vielleicht Verantwortung übernehmen. In dem Gesetze für modernen Arbeitnehmer:innenschutz erlassen und auch durchgesetzt werden.
Abschließend lässt sich festhalten: Die Digitalisierung hat den Informationsaustausch stark beschleunigt, was durchaus stressfördernd sein kann. Doch bei kluger Anwendung und achtsamem Einsatz können digitale Tools auch entlastend eingesetzt werden. Work smart, not hard.
Als Problem wird auch die mangelnde Benutzerfreundlichkeit digitaler Tools empfunden – was lässt sich dagegen unternehmen?
Die Benutzerfreundlichkeit digitaler Tools hat in den letzten Jahren tatsächlich zugenommen – insbesondere dank besserem UX-Design4 und der frühzeitigen Einbindung von Nutzerinnen und Nutzern in die Entwicklung. Gleichzeitig hat aber die Komplexität digitaler Anwendungen zugenommen, was die Einstiegshürde bei neuen Tools erhöhen kann und somit auch zu einer stärkeren «wahrgenommenen Benutzerunfreundlichkeit» führt.
Entscheidend ist daher, wie ein Tool eingeführt wird:
- Wurde die Notwendigkeit nachvollziehbar kommuniziert?
- Wurden Mitarbeitende frühzeitig eingebunden?
- Gab es ausreichend Training und Begleitung?
- Wurden konkrete Vorteile klar aufgezeigt – auch wenn sie sich erst langfristig entfalten?
Erst wenn diese Fragen positiv beantwortet werden können, wird Benutzerfreundlichkeit nicht nur technisch, sondern auch im Arbeitsalltag spürbar. Die Einführungen von neuen Tools als Change Projekt anzusehen und zu begleiten kann Organisationen helfen, das meiste aus IT Anwendungen und KI rauszuholen, ohne Mitarbeitende zu überfordern.
Welche zusätzlichen Stresspotenziale sehen Sie durch neue KI-Anwendungen – oder wie kann KI vielleicht helfen, digitalen Stress zu vermindern?
Auch bei der Einführung von KI-Anwendungen gelten die gleichen Prinzipien wie bei anderen digitalen Tools: transparente Kommunikation, aktive Einbindung der Mitarbeitenden und gezielte Schulung. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Ängste und Unsicherheiten abzubauen. Medienberichte mit Schlagzeilen wie „KI nimmt dir den Job weg“ müssen eingeordnet und relativiert werden.
Psychologische Sicherheit ist ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Zusammenarbeit und auch für Veränderungsbereitschaft. Die Harvard-Professorin Amy Edmondson hat gezeigt, dass Mitarbeitende, die sich sicher fühlen und von Führungskräften in ihrer Lernbereitschaft unterstützt werden, nicht nur besser lernen, sondern auch mehr zum Erfolg der Organisation beitragen. Entscheidend ist daher:
- Transparenz über Einsatzbereiche und Zwecke von KI
- Klarheit über Rollenverständnis und Verantwortlichkeiten
- Deutliche Abgrenzung zwischen Unterstützung und Kontrolle
Sind diese Rahmenbedingungen erfüllt, kann KI tatsächlich zur Reduktion von (digitalem) Stress beitragen:
- Repetitive Aufgaben werden automatisiert.
- Der Fokus kann stärker auf kreative oder kommunikative Tätigkeiten gelegt werden.
- Informationen lassen sich mittels LLMs leichter zugänglich machen.
- KI-basierte Assistenzsysteme können als digitale Coaches bei der Einführung neuer Tools unterstützen.
Unser Ansatz ist ein menschenzentrierter: KI soll nicht ersetzen, sondern unterstützen – und im besten Fall sogar zur Entlastung beitragen. Das sollten Organisationen stets im Blick haben und sich bei der Einführung und Nutzung von KI stets fragen, wie diese Menschen und die Organisation unterstützen kann und wie man die Menschen und die Organisation unterstützen kann, die KI effektiv und effizient zu nutzen.
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen sollte die Politik aus Ihrer Sicht gegen digitalen Stress am Arbeitsplatz schaffen?
Die Politik sollte klare Leitlinien für den Einsatz von KI am Arbeitsplatz entwickeln. Erste Grundlagen, etwa im europäischen AI Act, sind bereits geschaffen. Darüber hinaus ist es zentral, dass Forschung und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich digitaler Tools und KI weiterhin gefördert werden.
Gleichzeitig gilt es, einen ausgewogenen Regulierungsrahmen zu schaffen: Innovation darf nicht durch übermäßige Kontrolle ausgebremst werden. Der Arbeitnehmerschutz ist wichtig und muss gewährleistet werden, dennoch braucht es flexible Möglichkeiten, die der Einzigartigkeit von Organisationen und Individuen Rechnung trägt. Das ist eine anspruchsvolle Gratwanderung, die der politischen Debatte in den kommenden Jahren einiges abverlangen wird.
* Turkle, S. (2023). Always-on/always-on-you: The tethered self. In Social Theory Re-Wired (pp. 485-495). Routledge.
** Schermuly, C., & Meifert, M. (2023). Ergebnisbericht zum New Work-Barometer 2022. SRH Berlin.
*** Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. Journal of Management Information Systems, 24(1), 301–328.