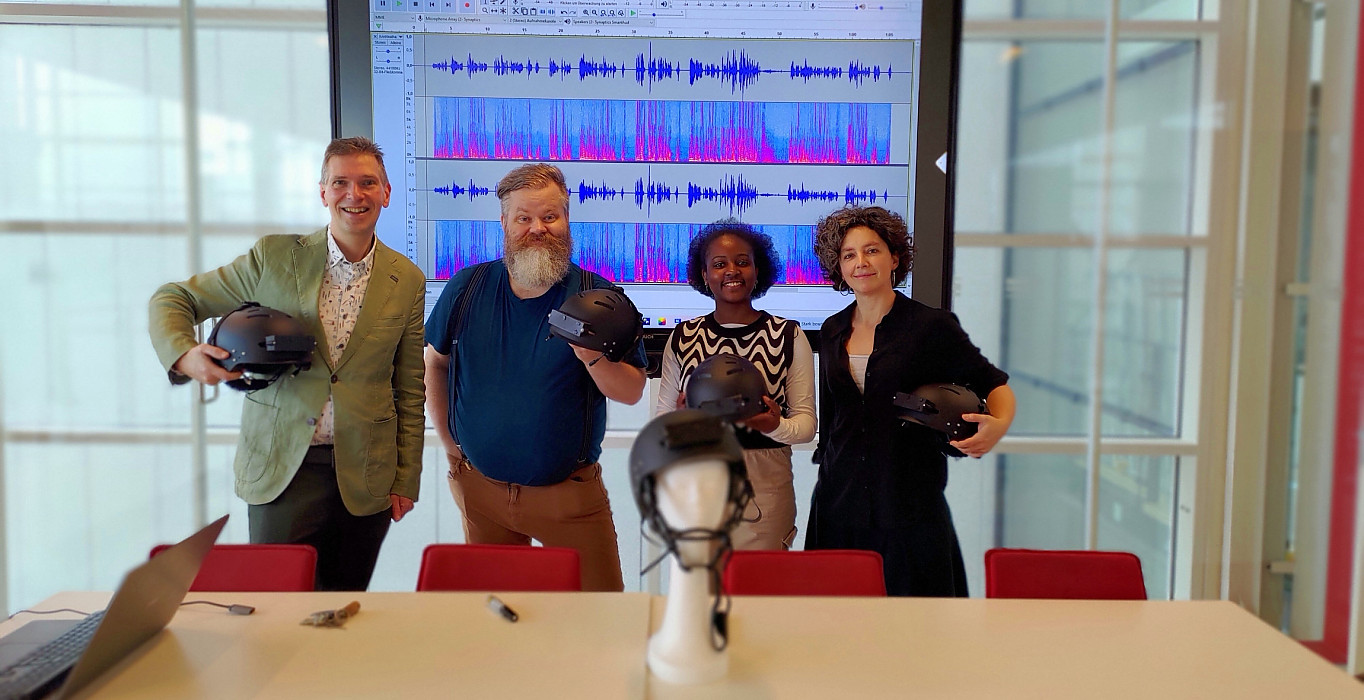Frau Jahn, die Initiative D21 forscht zur Resilienz im digitalen Wandel – warum ist diese so wichtig?
Resilienz ist weit mehr als ein persönliches „Mindset“ – sie ist ein zentraler Zukunftsfaktor für unsere Gesellschaft. In einer Zeit, in der technologische Entwicklungen immer schneller und komplexer werden, reicht technisches Wissen allein nicht mehr aus. Es braucht die Fähigkeit, mit Unsicherheit, Veränderung und Komplexität souverän umzugehen. Genau das beschreibt digitale Resilienz: den Wandel nicht nur erdulden, sondern ihn aktiv mitzugestalten.
2024 galten 63 % der deutschen Bevölkerung als digital resilient. Das heißt im Umkehrschluss: Jede*r Dritte droht, von der Welle des digitalen Wandels überrollt zu werden, statt von ihr getragen zu sein.
Die gute Nachricht: Resilienz ist nicht angeboren – sie kann erworben und gestärkt werden.
Für uns als Gesellschaft bedeutet das: Wir müssen gezielter fördern. Resilienz entsteht durch Unterstützung, durch Zutrauen und durch Erfahrungen, die Selbstwirksamkeit stärken. Bildungsangebote, die digitale Basiskompetenzen vermitteln, spielen dabei eine zentrale Rolle.
Aber es braucht auch digitalen Optimismus, soziale Netzwerke und Räume für gemeinsames Lernen – Orte, an denen man sich trauen darf zu fragen, und Formate, in denen Peer-to-Peer-Wissen geteilt wird.
Wenn wir Digitalisierung inklusiv denken wollen, ist Resilienz kein „nice to have“, sondern eine essenzielle Voraussetzung – für Teilhabe und Fortschritt gleichermaßen.
Das klingt, als würden digitale Tools das Leben vieler Menschen nicht automatisch einfacher machen – obwohl genau das ihr Ziel ist. Warum empfinden sie dennoch häufig eher zusätzliche Belastung?
Weil sie oft eingeführt werden, ohne dass Menschen wirklich verstehen, wie sie funktionieren oder welchen konkreten Nutzen sie haben. Statt Entlastung empfinden viele dadurch eher zusätzlichen Stress.
Der D21-Digital-Index zeigt: Nur 49 % der Bevölkerung verfügen über digitale Basiskompetenzen wie die Fähigkeit, online Informationen zu finden, Textprogramme zu nutzen oder sichere Passwörter zu verwenden. Das heißt, für die Hälfte ist schon der digitale Alltag mit Unsicherheiten verbunden. Das reicht von Homeoffice über Online-Formulare bis zur Kommunikation via Messenger. Wenn dann noch Updates, neue Tools oder neue Erwartungen dazukommen, entsteht schnell das Gefühl: Ich komme nicht mehr mit. Das überfordert – emotional wie kognitiv.
Was können Arbeitgebende konkret tun, um digitalen Stress in hybriden oder rein digitalen Arbeitsumgebungen zu reduzieren?
Ganz zentral ist, dass Arbeitgeber*innen den digitalen Wandel nicht einfach „laufen lassen“, sondern ihn aktiv und menschenzentriert gestalten. Dazu gehört zunächst eine kritische Auswahl der eingesetzten Tools: Nicht jede neue App ist automatisch sinnvoll. Vielmehr braucht es digitale Werkzeuge, die echte Probleme lösen, intuitiv nutzbar sind und den Arbeitsalltag spürbar verbessern. Noch wichtiger ist die Frage: Wie werden diese Tools eingeführt? Erfolgsfaktor Nummer eins ist hier eine begleitende, niedrigschwellige Einführung. Idealerweise mit kontinuierlicher Lernbegleitung, Feedbackmöglichkeiten und Austauschformaten im Team.
Denn: Viele Mitarbeitende fühlen sich mit den digitalen Anforderungen allein gelassen – und empfinden den ständigen Wandel als Belastung. Der D21-Digital-Index zeigt: Jede*r Dritte verfügt nicht über die nötigen Resilienzfaktoren, um mit diesem Wandel Schritt zu halten – geschweige denn, ihn aktiv mitzugestalten.
Ein Blick auf das berufliche Umfeld verdeutlicht den Einfluss von Arbeitsort und -modell: Menschen in Vollzeit sind resilienter als jene in Teilzeit (70 % vs. 61 %), Beschäftigte mit Schreibtischjob weisen mehr Resilienz auf als jene außerhalb des Büros (76 % vs. 57 %), und Führungskräfte fühlen sich dem Wandel eher gewachsen als Mitarbeitende ohne Führungsverantwortung (75 % vs. 65 %).
Das zeigt: Der Arbeitsplatz ist ein zentraler Ort, um Resilienz zu fördern – oder Menschen zu überfordern.
Welche zusätzlichen Stresspotenziale sehen Sie durch neue KI-Anwendungen – oder wie kann KI vielleicht helfen, digitalen Stress zu vermindern?
Künstliche Intelligenz ist derzeit einer der stärksten Treiber des digitalen Wandels. Einerseits kann sie enorme Entlastung bringen, etwa durch automatisierte Textvorschläge, das Vorsortieren von E-Mails, Chatbots im Kundenservice oder Tools, die Besprechungsnotizen und To-dos automatisch erfassen. Das kann Zeit sparen, Routinen vereinfachen und gerade in überladenen Arbeitskontexten Stress reduzieren. Viele Menschen erleben aber genau das Gegenteil: Sie fühlen sich durch KI-Anwendungen überfordert, durch Intransparenz verunsichert oder durch ihre Dynamik unter Druck gesetzt.
Denn KI-Systeme verändern nicht nur Tools, sondern oft auch Arbeitsprozesse und Zuständigkeiten und stellen damit eingespielte Rollen, Verantwortungen und sogar Identitäten infrage. Gerade wenn unklar ist, wie KI-Entscheidungen trifft, wie sicher sie mit sensiblen Daten umgeht oder ob generierte Informationen korrekt sind, entsteht das Gefühl von Kontrollverlust. Wenig hilfreich ist auch, dass in vielen Unternehmen keine klaren Leitlinien für den Einsatz von KI-Systemen bestehen – zu welchen Zwecken und in welchem Umfang KI eingesetzt werden darf, ist oft nicht klar geregelt. Solche Unsicherheiten belasten selbst digital affine Menschen und sind eine echte Herausforderung für die digitale Resilienz.
Deshalb braucht es begleitende Maßnahmen, sowohl technisch als auch kulturell. Unternehmen sollten neue KI-Tools nicht einfach ausrollen, sondern im Dialog einführen: mit verständlicher Kommunikation, Datenschutztransparenz und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Die Nutzer*innen müssen das Gefühl haben: Ich verstehe, was die KI macht, und ich kann Einfluss nehmen. Dann kann künstliche Intelligenz nicht nur Effizienz bringen, sondern auch digitale Selbstwirksamkeit stärken. Und genau das ist ein Schlüssel, um digitalen Stress langfristig zu reduzieren.
Was sind Ihre drei wichtigsten Tipps für Menschen, die sich vom digitalen Wandel überfordert und gestresst fühlen?
Erstens: Sich selbst Zeit geben. Digitale Kompetenzen wachsen durch Erfahrung. Kleine Schritte sind völlig okay und niemand muss alles sofort können.
Zweitens: Erfolgserlebnisse ermöglichen. Das Gefühl, ein digitales Problem selbst gelöst zu haben, stärkt Selbstvertrauen und Motivation. Besonders wirkungsvoll sind Peer-Formate, also das Lernen von und mit anderen auf Augenhöhe.
Drittens: Vergleiche kritisch reflektieren. In einer Welt voller Dauer-Updates und Online-Erlebnisse entsteht schnell das Gefühl, nicht mithalten zu können. Der „Joy of Missing Out“, die bewusste Entscheidung, nicht überall dabei zu sein, kann helfen, den eigenen digitalen Weg stressfreier zu gestalten. Digitalisierung muss kein Wettlauf sein. Sie darf auch einfach praktisch, hilfreich und menschlich bleiben.