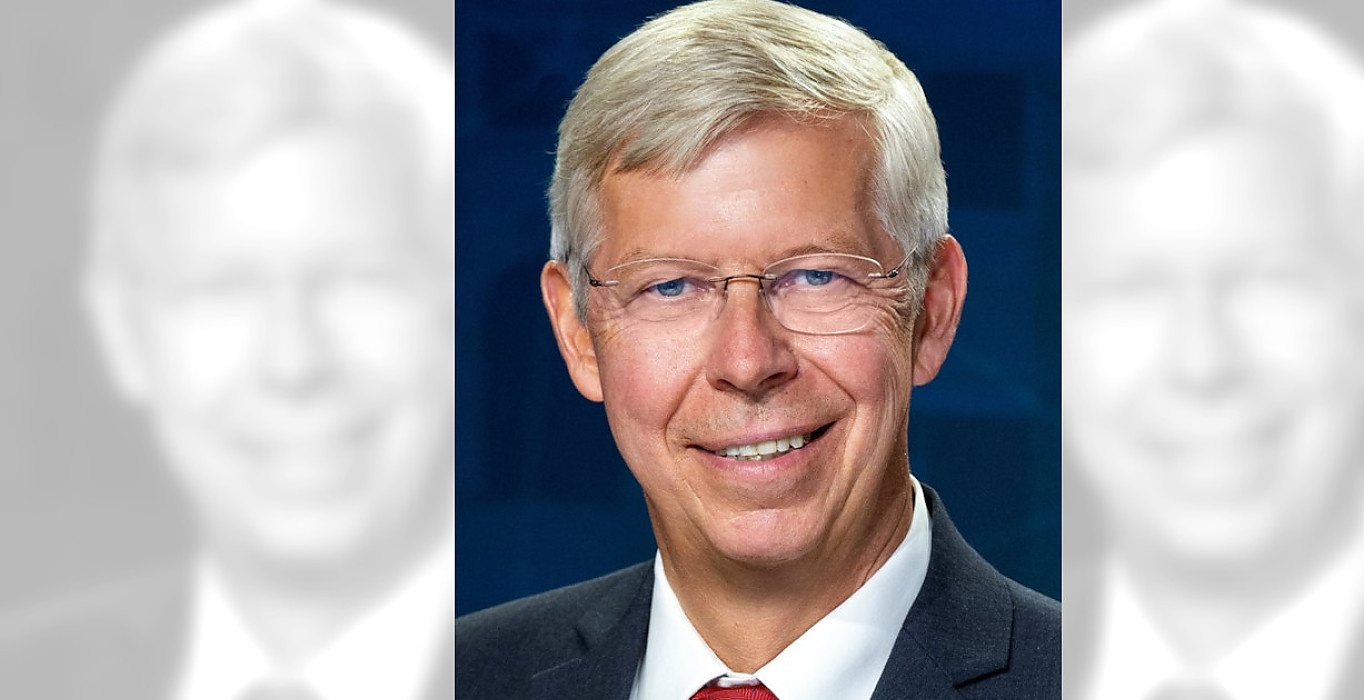Die EU will einen Europäischen Gesundheitsdatenraum schaffen. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Vorteile eines solchen?
Der Europäische Gesundheitsdatenraum (European Health Data Space, EHDS) bietet die Chance auf einen Mehrwert für Versicherte und die Sozialversicherungssysteme, nicht nur durch den digitalen, grenzüberschreitenden Zugriff auf Gesundheitsdaten für die medizinische Behandlung, sondern insbesondere auch durch deren sinnvolle Zusammenführung für die Forschung und die Politikgestaltung. Profitieren könnten theoretisch alle Disziplinen der Gesundheitsforschung – von der akademischen Versorgungsforschung bis hin zu produktorientierten Zulassungsstudien, bspw. im Bereich der seltenen Erkrankungen.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Welche technischen Hürden sind für einen gemeinsamen Gesundheitsdatenraum zu überwinden?
Der EHDS ist ein Projekt von enormem Ausmaß. Damit dieses erfolgreich umgesetzt werden kann, müssen die unterschiedlichen Digitalisierungsniveaus der Mitgliedstaaten angeglichen und kompatible Infrastrukturen für Gesundheitsdaten geschaffen werden. Die hierfür erforderlichen technischen Anforderungen sollten zu geringstmöglichen Anpassungen in den Mitgliedstaaten führen, etwa in Bezug auf die bestehenden IT-Systeme als auch die geltenden nationalen rechtlichen Rahmenbedingungen. Einheitliche europäische Formate und Spezifikationen, Identifikations- und Authentisierungsverfahren erfordern in Abhängigkeit von ihrer konkreten Ausgestaltung umfangreiche Anpassungen der aktuellen Telematik-Anwendungsstrukturen in Deutschland bzw. bei deren europäischen Pendants.
Welche Herausforderungen sehen Sie insbesondere in Sachen Datenschutz und IT-Sicherheit?
Der gemeinsamen europäischen Datennutzung muss ein gemeinsames europäisches Verständnis und eine einheitliche Praxis des Datenschutzes nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zugrunde liegen. Trotz der unmittelbar geltenden DSGVO sind in den Mitgliedstaaten durchaus unterschiedliche Konventionen bei deren Umsetzung festzustellen, die in der Vergangenheit insbesondere durch global operierende Digitalkonzerne für sie vorteilhaft genutzt wurden. Richtschnur im Umgang mit der DSGVO muss sein, dass der Schutz der persönlichen Daten sichergestellt, aber die notwendige und sinnvolle Digitalisierung der Strukturen im Sozial- und Gesundheitswesen nicht verhindert wird. Datenschutz und Digitalisierung müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinanderstehen. Das Gesetzgebungsverfahren zum EHDS bietet die Chance, dieses Verhältnis verantwortlich auszutarieren. Ein Problemfeld ist beispielsweise, dass die Zwecke, für die Gesundheitsdaten nach der DSGVO genutzt werden und wie sie im EHDS vorgesehen sind, in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. So gehen die Ausnahmeregelungen des Artikel 9 Abs. 2 DSGVO bisher ausschließlich von einer Nutzung personenbezogener Gesundheitsdaten aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit aus. Der Verordnungsvorschlag zum EHDS geht hingegen über diese zulässigen öffentlichen Zwecke hinaus und soll unter anderem auch Datennutzung für kommerzielle Zwecke ermöglichen.
Die sekundäre Datennutzung soll im EHDS auf Basis pseudonymisierter Versichertendaten erfolgen, bei denen Personen wenn nötig re-identifiziert werden können. Eine solche Re-Identifikation ist bspw. dann sinnvoll, wenn sie ermöglicht, dass Versicherte über einen kritischen Befund informiert werden können, der bei Datenverarbeitungsvorgängen zufällig entdeckt wird. Die Datenzugangsstellen sollten aber nicht über die Möglichkeit zur Re-Identifikation verfügen. Es bedarf hierfür einer getrennten Infrastruktur, in der Vertrauensstellen die Pseudonymisierung und Re-Pseudonymisierung der Daten vornehmen und als Bindeglied zwischen Datenzugangsstellen und Datenhaltern fungieren.
Was sollte aus Ihrer Sicht unbedingt in einem endgültigen Regelwerk stehen - und was auf keinen Fall?
Die von der Kommission vorgeschlagene Markteinführung von EHR durch internationale Anbieter könnte erhebliche Auswirkungen auf etablierte Strukturen und die Gesundheitssysteme in den Mitgliedstaaten haben. In Deutschland ist zum Beispiel die von den Krankenkassen angebotene elektronische Patientenakte (ePA) das zentrale Electronic Health Record („EHR“, im Sinne des EHDS) der Versicherten, in das alle relevanten Gesundheitsdaten fließen. Die ePA ist damit ein zentrales Element im wettbewerblich organisierten Krankenversicherungssystem, in deren Entwicklung zudem bereits erhebliche Investitionen aus Versichertengeldern geflossen sind. Bei den europäischen Vorgaben zum Inverkehrbringen und zur Inbetriebnahme von EHR-Systemen muss deshalb sichergestellt werden, dass bereits in den Mitgliedstaaten zugelassene EHR-Systeme mit dem Wirksamwerden der Verordnung weiter betrieben werden dürfen, auch um die nationale Akzeptanz der EHR-Systeme aufrechtzuerhalten.
Der Ansatz der Kommission für die Primärdatennutzung im EHDS, in Electronic Health Records („EHR“, im Sinne des EHDS) die gesamte Primärdokumentation sämtlicher Leistungserbringer sowie die Daten der Krankenkassen zentral zusammenzuführen, würde die laufende Umsetzung der deutschen ePA erheblich behindern. Denn in Deutschland sollen im Gegensatz zum Verordnungsvorschlag nur ausgewählte Informationen Eingang in die ePA finden. Über deren Freigabe entscheiden zudem die Patientinnen und die Patienten selbst. Die EHR sollten an ihrer national geplanten Funktion ausgerichtet bleiben.
Für eine erfolgreiche Umsetzung eines ambitionierten Großprojekts wie dem EHDS ist unbedingt notwendig, den vorgesehenen Zeit- und Regulierungsrahmen realistisch auszugestalten. Insbesondere mit Blick auf die Potenziale im Bereich der Sekundärdatennutzung erscheint es sinnvoll, diesen Bereich zeitlich vorzuziehen. Denn es ist davon auszugehen, dass eine Harmonisierung der Strukturen für die Primärdatennutzung von langwierigen politischen Einigungsprozessen mit hohem Detaillierungsgrad einhergehen wird. Der Zeitbedarf dieser Einigungsprozesse sollte nicht zu Lasten einer sinnvollen Sekundärdatennutzung gehen. Überdies sollte den Mitgliedstaaten beim Erlass der notwendigen konkretisierenden Durchführungsrechtsakte und delegierten Rechtsakte ein hinreichendes Maß an Kontroll- und Mitsprachemöglichkeiten eingeräumt werden.
Die Gesundheitsdatennutzung im Rahmen des EHDS sollte immer im öffentlichen Interesse erfolgen und dem Gemeinwohl dienen. Aus Sicht der Betriebskrankenkassen sollten Innovationen begünstigt werden, die zur Gesundheit oder sozialen Sicherheit beitragen. Die Nutzung von Gesundheitsdaten im Rahmen der Forschung und Politikgestaltung muss vorrangig den Versicherten sowie den Sozial- und Gesundheitssystemen zugutekommen. Zudem müssen die von der Solidargemeinschaft zur Verfügung gestellten und von Dritten genutzten Daten zu adäquaten Gegenleistungen führen. Wenn Daten der Solidargemeinschaften von Wirtschaftsunternehmen zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen verwendet werden, sollten die Solidargemeinschaften im Gegenzug durch finanzielle Kompensation davon profitieren. Forschungsergebnisse sind zudem stets öffentlich zugänglich zu machen.