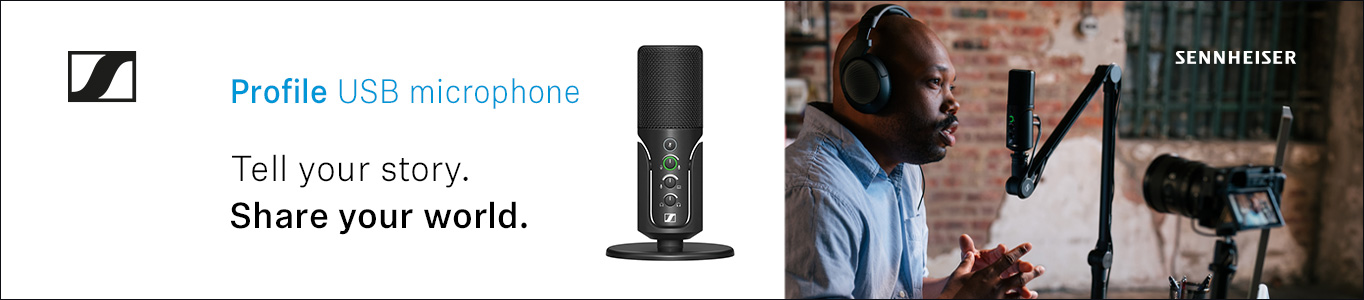Was sind die Gründe dafür, dass Menschen vermehrt auf digitale Hörangebote zurückgreifen als auf lineare?
Hier kann ich mit Blick auf die vergangenen Media Analysen zumindest für die Programme von Deutschlandradio einwenden: Nach wie vor ist die Nutzung linearer Programme sehr hoch, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova konnten hier in den vergangenen Jahren insgesamt sogar kontinuierlich Zugewinne verzeichnen.
Gleichzeitig beobachten wir, dass jüngere Hörerinnen und Hörer immer häufiger in der digitalen Welt, auf den Plattformen, in den Audiotheken und in der Welt der Podcasts unterwegs sind. Im Digitalen gibt es deutlich mehr Nutzungsszenarien, Publikumsinteressen und Verbreitungswege. Und insbesondere junge Nutzerinnen und Nutzern sind mit dieser Vielfalt der Inhalte und auch den Empfehlungssystemen der Plattformen aufgewachsen, lassen sich beispielsweise ihr Mix-Tape vom Algorithmus erstellen. Diese Menschen, die nicht mehr den Routinen der traditionellen Radionutzung folgen, möchten wir mit unseren Inhalten ebenfalls erreichen. Deshalb stärken wir unsere kostenlose Dlf-Audiothek App und bauen unsere non-linearen Angebote aus. Wir sind dort, wo sich unsere Hörerinnen und Nutzer bewegen, das sind unsere zwei Apps, unsere Webseiten und relevante Drittplattformen.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Was sind die wichtigsten Audiotrends und wie gelingt es Marketingverantwortlichen diese innerhalb kürzester Zeit den Konsumenten schmackhaft zu machen?
Der Podcast-Boom der vergangenen Jahre hat das Interesse an Audio und damit auch an radiofonen Formaten ordentlich angekurbelt. Hier denke ich aktuell besonders an Storytelling-Formate und Miniserien, die ja formal auch nah dran an traditionellen Radioformaten wie dem Feature sind.
Empfehlungssysteme und Algorithmen werden sicherlich noch weiter an Bedeutung gewinnen, um Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzubieten, also sehr nah dran an den Nutzungsbedürfnissen. Das gilt umso mehr für die Distribution unserer Inhalte auf Drittplattformen. Die Nutzerinnen und Nutzer suchen ihre Beiträge dort thematisch oder werden von einem Empfehlungssystem geführt. Das stellt uns vor die Herausforderung, dass unsere Programmmarken hier als Absender gut erkennbar sein müssen, unser Content sozusagen „mit uns nach Hause geht“. Gleichzeitig gilt: Wir senden drei Vollprogramme, die thematisch breit aufgestellt sind und verschiedene Perspektiven aufzeigen. Algorithmen für öffentlich-rechtliche Qualitätsmedien müssen aus meiner Sicht genau dies auch im Digitalen sicherstellen.
Aber nach wie vor ist das klassische, lineare Radiohören das häufigste Nutzungsszenario – mehr als 70 Prozent der Menschen in Deutschland hören regelmäßig Radio. Hier setzen wir bei Deutschlandradio, auch aus Gründen der Energieeffizienz, auf DAB+.
Für das Marketing bedeutet diese Gemengelage, dass wir einige Inhalte sehr spitz, granular bewerben müssen, z.B. in den sozialen Medien, gleichzeitig aber nicht aus dem Auge verlieren dürfen, dass wir ein Massenmedium sind, das sich an eine breite Öffentlichkeit richtet.
Mit welchen Werbeformaten und kreativen Entwicklungen könnte der Audiomarkt nachhaltig stabilisiert bzw. gewinnbringend vorangebracht werden – und sich dadurch auch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Video- und Bewegtbildformaten verschaffen?
Zunächst einmal: Die Programme von Deutschlandradio sind komplett werbefrei, wir entwickeln keine Werbeformate für Kunden. Bei der Bewerbung unserer eigenen Produkte haben wir – neben Cross-Promotion und klassischen Kanälen im Print oder Out-of-Home – zuletzt sehr gute Erfahrung mit Native Audio Ads in thematisch passenden Podcasts gemacht, auch manche Social-Media-Ausspielungen sind durchaus lohnend.
Funktioniert Werbung heutzutage überhaupt noch ohne digitale Algorithmus-basierte Vermarktungstechniken?
Deutschlandradio wird von der Allgemeinheit getragen und mit 54 Cent pro Monat von allen finanziert, wir produzieren und senden Programm für ein breites Publikum. Unser Programmangebot soll „Echokammern“ entgegenwirken, die durch Algorithmen entstehen können, das gilt auch für unsere Marketingaktivitäten. Sicherlich bieten Algorithmus-basierte Vermarktungstechniken Werbetreibenden effiziente Möglichkeiten, auch „spitze“ Zielgruppen passgenau zu erreichen und zu aktivieren. Letztendlich sollte aber jeder Media-Mix auf die jeweiligen Kampagnenziele und -botschaften abgestimmt sein, das kann dann auch eine Entscheidung für klassische Medien wie Print oder Außenwerbung bedeuten. Daher werden detaillierte Kenntnisse über die Zielgruppen bzw. die Nutzung der zu bewerbenden Produkte und Programme auch in Zukunft die Grundlage für gutes Marketing bleiben.