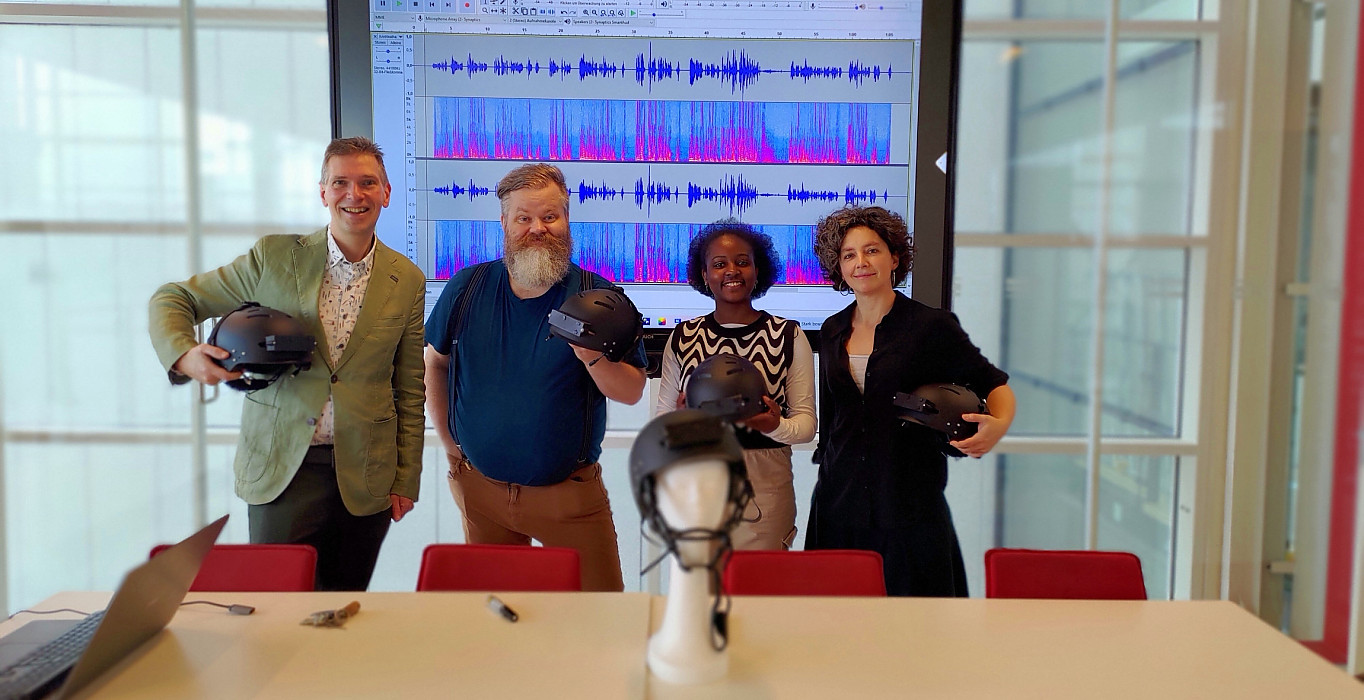Digitale Lernformate prägen die Weiterbildung zunehmend. Welche Bedeutung haben solche Formate aus Ihrer Sicht?
Digitale Lernformate sind aus der Weiterbildung nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen flexibles, orts- und zeitunabhängiges Lernen, eröffnen neue didaktische Möglichkeiten und schaffen bessere Zugänge – gerade für Menschen, die aus beruflichen, familiären oder gesundheitlichen Gründen keine klassischen Kursformate besuchen können. Aus Sicht des Deutschen Volkshochschul-Verbands (DVV) sind digitale Lernformate zugleich ein zentraler Hebel für mehr Bildungsgerechtigkeit in einer digitalisierten Gesellschaft.
Volkshochschulen ermöglichen orts- und zeitunabhängiges Lernen über digitale Plattformen, bieten hybride Formate und verknüpfen technologische Möglichkeiten mit didaktischer Qualität. Zugleich achten sie darauf, niemanden auszuschließen: Ihre Angebote richten sich an alle – unabhängig von Bildungshintergrund, Lebenssituation oder digitalen Vorkenntnissen.
Volkshochschulen stehen dafür bereit: Mit über 850 Standorten deutschlandweit, einem breiten Kursportfolio und der vhs.cloud als gemeinsamer Lernplattform bieten sie niedrigschwellige Zugänge zu digitaler Bildung – von ersten Schritten bis hin zu spezialisierten Online-Kursen. Mehr als 800 Volkshochschulen nutzen die vhs.cloud aktiv für digital unterstütztes Lernen. Im Jahr 2021 konnten wir über 1,9 Millionen Unterrichtsstunden mit digitalen Inhalten verzeichnen – ein klares Zeichen für die Innovationskraft und Reichweite der Einrichtungen.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Nach einer aktuellen Untersuchung halten etwa drei Viertel der Beschäftigten digitale Weiterbildung für wichtig. Welchen Nachhol-Bedarf sehen Sie in diesem Bereich?
Das wachsende Interesse an digitaler Weiterbildung ist ein positives Signal – doch es spiegelt sich noch zu wenig in strukturellen Angeboten wider. Der Zugang ist oft abhängig von Region, Arbeitgeber oder persönlicher Ressourcenlage. Viele Menschen erleben digitale Weiterbildung als schwer zugänglich, überfordernd oder nicht passgenau.
Volkshochschulen begegnen diesem Nachholbedarf mit niedrigschwelligen, praxisnahen Angeboten – ergänzt durch individuelle Lernberatung und eine ausgeprägte Kultur des Ermöglichens. Sie sind für viele Menschen der erste Kontaktpunkt zu Bildung, da sie als wohnortnahe Einrichtungen bekannt sind und jährlich mehrere Millionen Menschen erreichen.
Gleichzeitig sehen wir jedoch weiterhin Nachholbedarf im Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Lehrkräftequalifizierung in digitalen Kompetenzen. Daher fordern wir von der Politik eine gezielte Förderung digitaler Ausstattung, die Entwicklung von Qualitätsstandards in der digitalen Lehre und vor allem eine gesicherte Finanzierung, um die Qualifizierung der Lehrkräfte im digitalen Raum systematisch voranzutreiben.
Rund zwei Drittel haben Interesse an KI-gestützten Trainingsformaten - welche Potenziale sehen Sie hier?
KI-gestützte Formate bieten große Chancen für die Weiterbildung: Sie können Lernprozesse personalisieren, Inhalte adaptiv gestalten, Übersetzungen automatisieren oder Barrieren abbauen. Für viele Lernende bedeutet das: mehr Passgenauigkeit, mehr Motivation und mehr Lernerfolg.
Doch KI im Bildungsbereich darf kein Selbstzweck sein. Wir vertreten eine klare Haltung: Der Mensch nutzt KI – nicht umgekehrt. Deshalb stehen für den DVV immer der pädagogische Nutzen und die Emanzipation der Lernenden im Vordergrund. Wir setzen uns dafür ein, dass KI-Technologien als Werkzeuge verstanden werden – Werkzeuge, die Menschen darin unterstützen, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden und sie aktiv mitzugestalten.
Volkshochschulen vermitteln sowohl technische Grundlagen als auch die Fähigkeit, KI kritisch zu reflektieren. Das schließt Aspekte wie Datenschutz, algorithmische Verzerrung oder Deep Fakes mit ein. Damit stärken wir eine informierte, mündige Gesellschaft.
60 % glauben allerdings auch, dass KI bewährte Formate nicht ersetzen wird. Wie sehen Sie das?
KI kann Bildungsprozesse unterstützen, aber sie ersetzt keine zwischenmenschliche Interaktion. Lernen ist mehr als Informationsaufnahme – es ist ein sozialer, dialogischer und oft emotionaler Prozess. Gerade die Volkshochschulen stehen für Begegnung, Austausch und Gemeinschaft – Qualitäten, die durch keine Technologie ersetzt werden können.
Deshalb setzen wir auf ein „sowohl als auch“: KI wird da genutzt, wo sie Lernen verbessern kann – etwa durch Automatisierung oder individuelle Anpassung. Gleichzeitig bleiben persönliche Begegnungen, partizipative Lernformen und didaktische Begleitung durch qualifizierte Lehrkräfte unverzichtbar. Unser Ziel ist eine pädagogisch kontrollierte Integration von KI, die menschliche Autonomie fördert, statt sie einzuschränken.
Bildung muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen – nicht die Technologie. Damit das gelingt, müssen wir KI-Entwicklung und -Einsatz im Bildungsbereich aktiv mitgestalten: mit Transparenz, ethischer Verantwortung und mit einem klaren Fokus auf das, was gute Bildung ausmacht.