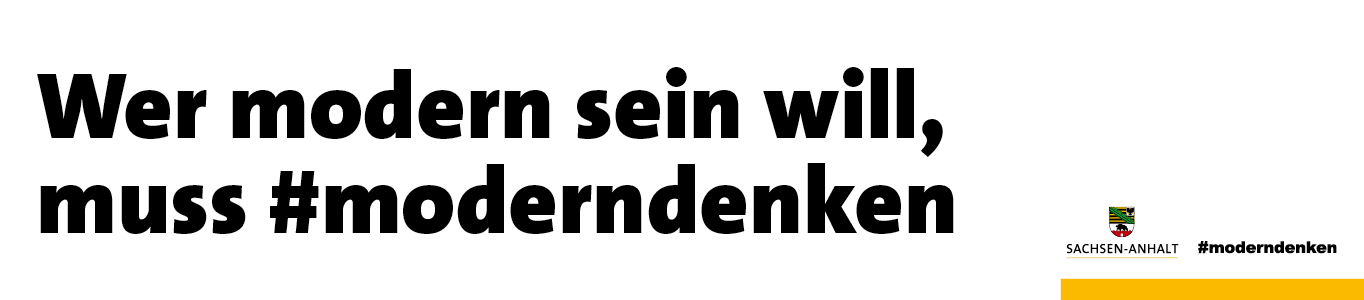Welche Auswirkungen hat der Konsum von Social-Media-Angeboten auf unser Verhalten, Familienleben und soziale Kompetenz von Heranwachsenden?
Social-Media-Plattformen bieten Kindern und Jugendlichen wichtige Informationsquellen, Freizeit- und Unterhaltungserlebnisse sowie soziale und kreative Erfahrungs- und Entfaltungsräume. Hieraus ergeben sich bedeutsame Chancen für die Entwicklung hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Soziale Medien bergen jedoch auch diverse Risiken für Kinder und Jugendliche, deren Entwicklung die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz kontinuierlich im Blick behält und in ihrem „Gefährdungsatlas“ einordnet. Diese Risiken entstehen im Kontext der strukturellen Ausgestaltung des Dienstes, der dort verfügbaren redaktionellen und nutzergenerierten Inhalte sowie des Verhaltens der Nutzerinnen und Nutzer. Dazu zählen beispielsweise Konfrontationen mit jugendschutzrelevanten Inhalten sowie Interaktionen mit schädigenden Dritten. Im Rahmen dessen können Kinder und Jugendliche sozialethisch desorientierende Werte, Normen, Einstellungen und Verhaltensweisen übernehmen. Weitere Risiken können sich aus dem Einsatz von Kauffunktionen und nicht altersgerechten Kaufappellen ergeben sowie aus Mechanismen, die ein exzessives Nutzungsverhalten fördern. Hierbei lassen sich angebotsbezogene Faktoren identifizieren, die für einen hohen Nutzungsumfang verantwortlich gemacht werden. Solche Faktoren sind zum Beispiel algorithmische Empfehlungssysteme oder aufmerksamkeitssteuernde Funktionen wie Likes und Pushnachrichten.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Wie kann man Kinder und Jugendliche für manipulative Funktionen bei Social-Media-Plattformen sensibilisieren?
Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Teilhabe, Schutz und Befähigung im digitalen Raum. Diese kinderrechtliche Perspektive ist entsprechend Kern des Jugendschutzgesetzes (JuSchG). Damit Kinder und Jugendliche die für sie relevanten Plattformen möglichst unbeschwert nutzen können, müssen sie und ihre Bezugspersonen einerseits die manipulativen Mechanismen kennen, von denen Social-Media-Dienste Gebrauch machen, wie unter anderem aufmerksamkeitssteuernde Funktionen, Kostenfallen sowie algorithmische Empfehlungssysteme. Oder aber auch jene Mechanismen, die von Nutzerinnen und Nutzern selbst genutzt werden, wie Werbung und Kaufappelle durch Influencerinnen und Influencer. Andererseits sollten Kinder und Jugendliche über die sich daraus ergebenen Risiken und Konsequenzen sowie mögliche Handlungsstrategien umfassend aufgeklärt werden. Vor diesem Hintergrund bietet die Bundeszentrale für Kinder und Jugendmedienschutz im Auftrag des Jugendschutzgesetzes Orientierungshilfen wie den Gefährdungsatlas oder Förderprogramme an und schafft Synergien mit bereits existierenden Projekten und Maßnahmen der Medienbildung.
Strategien wie Dark Patterns und Digital Nudging wurden als manipulativ entlarvt. Sollte es gesetzlich geregelte Grenzen für verhaltensbeeinflussende Mediendesigns geben?
Generell braucht es natürlich gesetzliche Rahmungen wie zum Beispiel das Jugendschutzgesetz. Innerhalb derer sollten aber vor allem in Bereichen, die einem permanenten Wandel unterzogen sind, auch flexible untergesetzliche Verabredungen und Maßnahmen getroffen werden, mit denen schnell auf aktuelle Entwicklungen reagiert werden kann. Hier ist die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz aktiv: im Rahmen des interdisziplinären Diskursformats der ZUKUNFTSWERKSTATT kommen regelmäßig Expertinnen und Experten des Kinder- und Jugendmedienschutzes und die Anbieter der relevanten Dienste zusammen, um über Verbesserungen in den Diensten zum Schutz von Kindern und Jugendlichen bei der Nutzung zu beraten.
Wie kann die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen insgesamt gestärkt werden?
Kinder- und Jugendmedienschutz ist eine ganzheitliche Aufgabe. Maßgebliches Wesensmerkmal dieser Aufgabe ist ein intelligentes Chancen- und Risikomanagement unter Einbezug der gesamten Verantwortungsgemeinschaft aus Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Ziel muss sein, gemeinsam die Kinderrechte auf Schutz, Befähigung und Teilhabe zu verwirklichen. Entsprechend ist auch die Aufgabe der Medienkompetenzförderung zu sehen. Kinder und Jugendliche brauchen übergreifende und niedrigschwellige Angebote zur Orientierung bei der Mediennutzung und Medienerziehung. Es gilt aber auch ihre Bezugspersonen und die Medienpädagogik entsprechend zu stärken. Befähigungs- und Unterstützungsangebote sollten frühzeitig alle Lebensbereiche adressieren: Pädagogische Institutionen wie Kindertagesstätten und Schulen, die Familienbildung, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch die bei Kindern und Jugendlichen beliebten digitalen Medien selbst. Diese könnten die Medienkompetenz ihrer jungen Nutzerinnen und Nutzer beispielsweise durch eigene kind- und jugendgerecht aufbereitete Formate stärken, die zu ihrem jeweiligen Dienst passen.