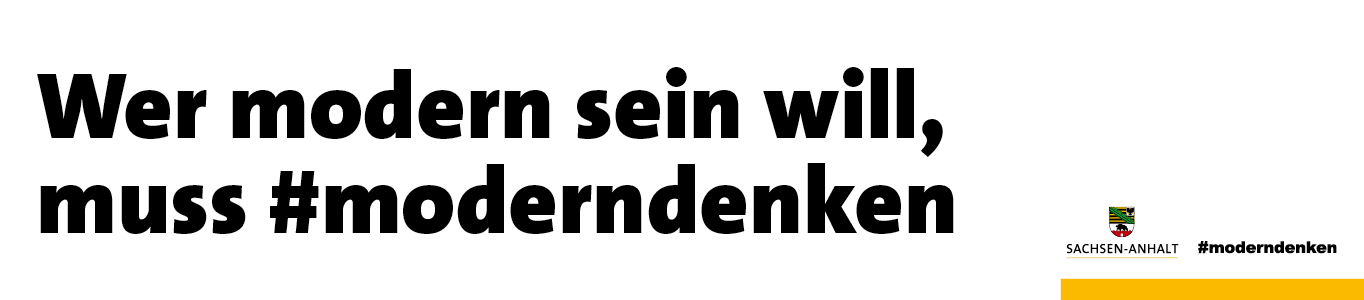Welche Auswirkungen hat der Konsum von Social-Media-Angeboten auf unser Verhalten, Familienleben und soziale Kompetenz von Heranwachsenden?
Die Nutzung von Social-Media-Angeboten ist für viele Menschen integraler Bestandteil ihres Alltagslebens, sie fördert ihre Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben. Neben diesen Vorteilen birgt die Nutzung auch Nachteile, zum Beispiel die sog. Fear of Missing out, also die Furcht etwas zu verpassen, wenn die Social-Media-Aktivitäten nicht jederzeit verfolgt werden, oder die besonders bei Kindern und Jugendlichen ausgeprägte Angst vor Cybermobbing. Problematisches Nutzungsverhalten kann durch Strukturmerkmale der Plattformen verstärkt werden, wozu auch Nudging, Dark Patterns und algorithmische Empfehlungssysteme (AES) zählen. Letztere basieren u. a. auf Daten aus dem Nutzungsverhalten der Teilnehmenden. Welche Daten genau genutzt werden, wird von den Unternehmen aber kaum offengelegt. Hierin liegen Herausforderungen, die sich allen Nutzer*innen stellen, von denen Kinder und Jugendliche aber in besonderem Maße betroffen sind. Die Folgen daraus können die Präsenzaktivitäten und das Familienleben stören. Außerdem können solche Mechanismen auch den Zugang zu Inhalten verstärken, die für Heranwachsende risikobehaftet sind, oder zur Nutzung kostenpflichtiger Elemente verlocken. Dass diese Entwicklungen besonders die elterliche Medienerziehung stark herausfordern, zeigt der Jugendmedienschutzindex 2022.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Wie kann man Kinder und Jugendliche für manipulative Funktionen bei Social-Media-Plattformen sensibilisieren?
Im Projekt „Digitales Deutschland | Monitoring zur Digitalkompetenz der Bevölkerung“ (https://digid.jff.de/) hat sich gezeigt, dass es besonders zielführend ist, an Irritationsmomente anzuknüpfen, die Kinder und Jugendliche im Kontext ihrer Mediennutzung erfahren. Junge Menschen sind häufig irritiert, wenn sichtbar wird, dass Plattformangebote überraschend viel über ihr Privatleben „wissen“ und nicht deutlich wird, woher diese Informationen stammen. Als besonders unangenehm empfinden sie auf AES basierende passgenaue Vorschläge ohne ersichtlichen Grund, aber auch Vorschläge, die überhaupt nicht mit dem bisherigen Nutzungsverhalten im Einklang stehen. Hierüber Diskurse zu Praxen des Datensammelns und -verarbeitens durch Plattformen sowie zu ihren Marktetingstrategien und Verwertungslogiken anzustoßen, knüpft an die Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder und Jugendlichen an und bietet lebensweltnahe Möglichkeiten der Kompetenzaneignung. In der Arbeit mit jungen Menschen im Projekt ACT ON zeigte sich dies wiederholt, auch wurden dort medienpädagogische Methoden dafür entwickelt.
Strategien wie Dark Patterns und Digital Nudging wurden als manipulativ entlarvt. Sollte es gesetzlich geregelte Grenzen für verhaltensbeeinflussende Mediendesigns geben?
Wir fokussieren in unserer Arbeit auf Kinder und Jugendliche. Und hier gilt: Je jünger die Nutzer*innen von Angeboten sind, umso stärker sollten Fragen zum Kinder- und Jugendmedienschutz das Handeln prägen. Rechtliche Regulierungsansätze sind hier ein wichtiges Mittel. Damit können diese vulnerablen Zielgruppen geschützt werden. Ein rein bewahrpädagogisches Vorgehen erschwert jedoch, dass junge Zielgruppen einen kompetenten Umgang mit entsprechenden Herausforderungen erlernen. Leider trägt die Dynamik der technischen Entwicklung zudem dazu bei, dass Gesetzesentwürfe häufig der Realität hinterherhinken. Es braucht also beides: rechtlich Gesetzte Grenzen und auch Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung.
Das kann am Beispiel Transparenz verdeutlicht werden. Es ist sinnvoll, Transparenz gesetzlich zu fordern. Was das aber bedeutet, Transparenz in Online-Diensten umzusetzen, erscheint sinnvoll in untergesetzlichen Abstimmungsprozessen bspw. in Gestaltungsrichtlinien für Supportive Design oder für Safety-by-Design zu konkretisieren. Diese können dann schneller angepasst werden auf neue Entwicklungen und Medienphänomene. Dabei muss bspw. die Erkenntnis berücksichtigt werden, dass allein Informationen in den AGB eine nicht hinreichende Grundlage für informierte Entscheidungen von Jugendlichen sind. Neben den gesetzlichen Forderungen nach Transparenz und der Übersetzung in Gestaltungsrichtlinien ist damit aber auch deutlich, dass für alle Altersgruppen die Förderung von Medienkompetenz erforderlich ist.
Idealerweise können hier auch technologische Möglichkeiten genutzt werden, um beide Aspekte miteinander zu verbinden. So sollten Informationen zum Thema Nudging bereitgestellt werden, die dieses Prinzip und die dafür genutzten Daten nachvollziehbar machen. Zugleich kann Nudging auch genutzt werden, um problematische Inhalte besser zu kontextualisieren. Neben Inhalten mit potenziell desinformativen, diskriminierenden oder demokratiegefährdenden Inhalten könnten bspw. Inhalte aus der medienpädagogischen und politischen Bildungsarbeit ausgespielt werden, wenn die erstgenannten Inhalte nicht ohnehin gelöscht werden müssen.
Wie kann die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen insgesamt gestärkt werden?
Wichtig mit Blick auf die Medien- und Digitalkompetenz von Kindern und Jugendlichen ist es, deren unmittelbare Bezugspersonen und pädagogische Fachkräfte zu integrieren. Dies gilt sowohl im familiären Bereich als auch für Schule und Freizeit, zumal Social Media-Nutzung hier überall eine Rolle spielt. Sie müssen mit Informationen, Weiterbildungsangeboten und Methoden unterstützt werden, um das Medienhandeln von Kindern und Jugendlichen souverän begleiten zu können. Fachkräfte finden Informationen über neue Trends und methodische Anregungen beispielsweise beim Projekt ACT ON (https://act-on.jff.de). Dort erklären auch Heranwachsende ihre Sichtweise, das erleichtert geeignete Ansatzpunkte zu finden und ihre Schutz- und Teilhabebedürfnisse zu verstehen. Auch Eltern jüngerer Kinder äußern teilweise großen Unterstützungsbedarf, wie u.a. der Jugendmedienschutzindex (2022) herausstellt. Kompetent mit Social-Media-Angeboten und anderen Phänomenen des digitalen Wandels umgehen zu können, ist keine Pflicht von Einzelnen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Hierfür sollten entsprechende Voraussetzungen und Strukturen geschaffen bzw. weiter ausgebaut werden – bspw. mit der Weiterentwicklung von supportive Design-Richtlinien.