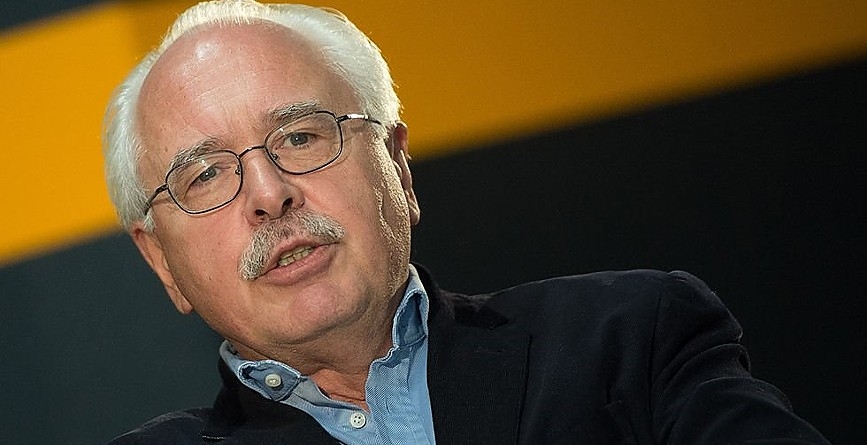Politiker fordern europaweit einheitliche Regeln für das sogenannte Geofencing, um sensible Infrastrukturen vor Drohnen-Vorfällen zu schützen. Wie bewerten Sie das?
„Geofencing“ ist ein hilfreiches und sinnvolles technisches System für Drohnen. Damit können Lufträume, Zonen und Gefahrengebiete erkannt werden, in die nicht eingeflogen oder in denen eine Drohne nicht in den Betrieb versetzt werden darf. Diese Information wird im Steuerungssystem von Drohnen automatisch so umgesetzt, dass die Drohne in den geschützten Bereich keinesfalls einfliegt und der remote-pilot eine Warninformation erhält.
Einige Drohnenhersteller haben derartige Systeme in ihren Drohnen bereits serienmäßig installiert. Der UAV DACH e.V. hat aus Gründen der Flugsicherheit „Geofencing“ für alle Drohnen gefordert. Leider ist die europäische Regelung für den Betrieb von unbemannten Luftfahrzeugen an dieser Stelle „weich“ geworden. Es ist nur noch „Geo-awarness“ bei bestimmten Missionen gefordert. D.h. der Pilot bekommt eine Information, dass die Gefahr besteht in einen „gesperrten“ Luftraum einzufliegen. Er kann dann selbst in die Steuerung eingreifen. Ganz wichtig ist momentan, dass die technischen Spezifikationen für „Geo-awareness“ europaweit harmonisiert und standardisiert werden und dass nicht zu befliegende Lufträume nach einheitlichen Kriterien und Verfahren festgelegt werden.
Welche Objekte sollten derart vor Drohnen-Vorfällen geschützt werden – und welche eher nicht?
Für mich ist es unzweifelhaft, dass besonders kritische Infrastrukturen vor Drohnen-Vorfällen geschützt werden müssen. Die Kollision eines Airliners mit einer Drohne könnte katastrophale Folgen haben. Daher brauchen auf jeden Fall die Verkehrsflugplätze eine Schutzzone, in der nur genehmigte und koordinierte Drohnenflüge stattfinden dürfen.
Weiterhin sollte es ein Überflugverbot über Industrieanlagen geben, bei denen der Absturz einer Drohne zur Störfallauslösung führen würde. Das sind Industrieanlagen bei denen gefährliche Stoffe in größeren Mengen produziert, verarbeitet oder gelagert werden. Man soll es aber auch nicht übertreiben mit der Festlegung von Drohnenverbotszonen. In vielen Fällen ist die Vorschrift, dass der Pilot so fliegen muss, dass keine Gefahr für Menschen, Sachen oder die Natur entsteht, als ausreichend anzusehen.
Drohnen werden auch von der Feuerwehr oder zur Lebensrettung eingesetzt – wie sollten die Regeln ausgestaltet sein, damit deren Einsätze nicht eingeschränkt werden?
Die Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sind von dem noch bis Juni 2020 geltenden deutschen Luftrecht für Drohnen befreit. Ab Juli 2020 ist dann die europäische Betriebsverordnung für Drohnen anzuwenden. BOS sind von diesen Regeln ausgenommen, wenn sie Drohnen für Polizeiaufgaben, Such- und Rettungsdienste, Brandbekämpfung, die Grenzkontrolle und Küstenwache oder ähnliche Tätigkeiten oder Dienste einsetzen. Solche Sonderrechte müssen in Anspruch eingeräumt werden, wenn es beispielsweise um Menschenleben und Katastrophenbekämpfung geht. Trotzdem müssen die BOS den Flugbetrieb so durchführen, dass sie nicht selbst zur Gefahr im Luftraum werden. Die deutschen BOS haben sich dazu ein internes Regelwerk gegeben, was ich sehr begrüße.
Die Zahl der Drohnen steigt auch fernab der kritischen Infrastruktur - welche rechtlichen Vorgaben braucht Europa für diese Art von Luftverkehr aus Ihrer Sicht am dringendsten?
Mit Drohnen können viele sinnvolle Aufgaben erledigt werden, beispielsweise auch in der Land- und Forstwirtschaft. Aber auch im ländlichen Bereich muss der Betrieb von Drohnen sicher sein. Das neue europäische Luftrecht ist mit dem risikobasierten Ansatz in die richtige Richtung gegangen. Soweit der Betrieb nicht in der sog. offenen Kategorie stattfindet (geringstes Risiko), ist jede Mission nach Sicherheitsgesichtspunkten zu prüfen. Die Betriebsgenehmigung wird nur erteilt, wenn „air-risk“ und „ground-risk“ in einem verträglichen Rahmen liegen.