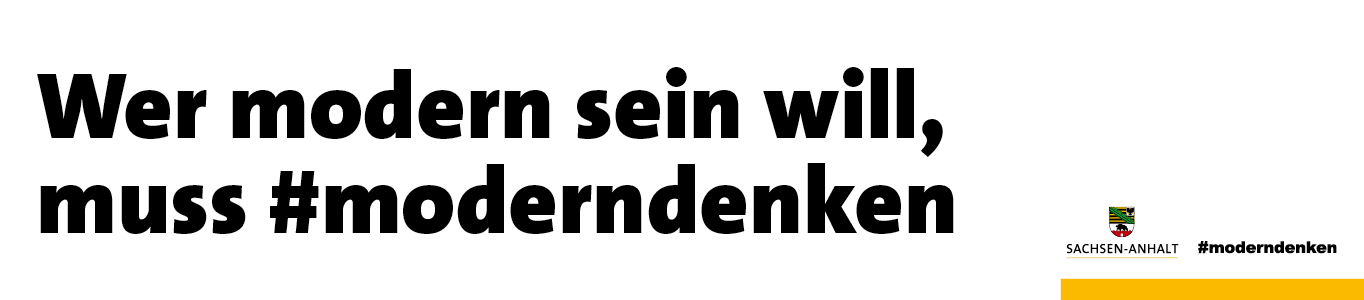Welche Auswirkungen hat der Konsum von Social-Media-Angeboten auf unser Verhalten, Familienleben und soziale Kompetenz von Heranwachsenden?
Die Diskussion um die Auswirkungen der Nutzung von Social-Media-Angeboten auf die Entwicklung von Jugendlichen wird seit Jahren intensiv geführt und es ist wichtig, die möglichen Vorteile und Gefahren für diese Altersgruppe zu verstehen. Positiv hervorzuheben ist, dass Social-Media-Angebote die Vernetzung und Kommunikation von Jugendlichen fördern, da sie den Austausch mit Gleichaltrigen ermöglichen. Darüber hinaus bieten sie eine Plattform für den kreativen Selbstausdruck und die Identitätsbildung, indem sie die Möglichkeit bieten, Interessen und Meinungen zu teilen und weiterzuentwickeln. Auch fungieren Social-Media-Angebote als Bildungsressource, die den Zugang zu einer Vielzahl von Informationen und Perspektiven ermöglicht und damit die Neugier und das kritische Denken der Heranwachsenden fördert. Die Nutzung von Social-Media-Angeboten birgt auch Risiken. Sie kann bei Jugendlichen zu Selbstwertproblemen führen, indem der Vergleich mit idealisierten Vorbildern das eigene Selbstbild beeinträchtigt. Die intensive digitale Vernetzung kann zudem eine Abhängigkeit fördern, die beispielsweise die wertvolle Zeit für Offline-Aktivitäten wie Sport und persönliche Treffen einschränkt. In diesem Umfeld sind junge Menschen auch potenziellen Gefahren wie Cybermobbing, Datenschutzverletzungen und der Konfrontation mit unangemessenen Inhalten ausgesetzt, die ihre emotionale und physische Sicherheit gefährden können.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Wie kann man Kinder und Jugendliche für manipulative Funktionen bei Social-Media-Plattformen sensibilisieren?
Die Landesmedienanstalten setzen auf Information und Aufklärung, um Eltern und Jugendliche über die manipulativen Funktionen von Social-Media-Plattformen zu informieren und einen verantwortungsvollen Umgang zu fördern. Dazu bieten sie in den jeweiligen Bundesländern Workshops und Informationsveranstaltungen in Schulen sowie Familien- und Jugendeinrichtungen an, in denen Medienpädagoginnen und Medienpädagogen über Mechanismen wie Algorithmen, Filterblasen, KI und Big Data sprechen. Darüber hinaus stellen sie in gemeinsamen Projekten wie www.klicksafe.de, www.juuuport.de oder www.handysektor.de umfangreiche Online-Angebote zur Verfügung, darunter Ratgeber, Erklärvideos und Informationsmaterialien, die auch aufzeigen, wie Plattformen das Nutzerverhalten steuern und Daten nutzen. Darüber hinaus initiieren die Landesmedienanstalten Aktionstage und TV-Diskussionsrunden, die zum Beispiel über Bürgerfernsehen ausgestrahlt werden, um eine breite Öffentlichkeit zu erreichen und für Themen wie Desinformation, Cybermobbing und Datenschutz zu sensibilisieren.
Strategien wie Dark Patterns und Digital Nudging wurden als manipulativ entlarvt. Sollte es gesetzlich geregelte Grenzen für verhaltensbeeinflussende Mediendesigns geben?
Dark Patterns sind Designmuster, die Nutzende zu einem bestimmten Verhalten verleiten und den Interessen der Anbietenden von Benutzeroberflächen dienen. Gesetzliche Grenzen bzw. Ansätze ergeben sich hier bereits aus dem Datenschutz-, Vertrags- und Lauterkeitsrecht. Aber auch im Medienrecht existieren Regelungen, z. B. zu Kennzeichnungspflichten für Diensteanbieter hinsichtlich Erkennbarkeit, Transparenz und Zugänglichkeit oder auch im Hinblick auf Kinder und Jugendliche. Dark Patterns sind bei vielen Free2Play-Apps Teil des Geschäftsmodells und dienen der Kundenbindung und der Monetarisierung. Insbesondere Heranwachsende haben Mühe, die oft subtilen Mechanismen zu durchschauen und mögliche Kostenrisiken oder im Spiel angebotene Vorteile zu beurteilen. Im Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) gibt es deshalb Regelungen, die im Kontext von Werbung das Ausnutzen der Unerfahrenheit und Leichtgläubigkeit von Kindern und Jugendlichen verbieten, zumindest wenn es sich um ein Angebot handelt, das sich auch an Kinder und Jugendliche richtet. Außerdem kann bei massiver Förderung einer exzessiven Nutzung von einer Entwicklungsbeeinträchtigung nach JMStV ausgegangen werden. Hier bieten sich also Handlungsmöglichkeiten für die Aufsicht. Schließlich verpflichtet das Jugendschutzgesetz Anbietende von Spiele-Apps und Online-Games dazu, Kauffunktionen und Mechanismen, die eine exzessive Nutzung fördern, in der Alterskennzeichnung zu berücksichtigen. Rechtliche Ansätze hinsichtlich verhaltensbeeinflussender Mediendesigns sind also durchaus vorhanden, bedürfen aber der konsequenten Umsetzung. Und schließlich kommen wir nicht umhin, das Bewusstsein für solche Mittel und Strategien durch Medienbildung zu stärken.
Wie kann die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen insgesamt gestärkt werden?
Um die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen zu stärken, betonen die Landesmedienanstalten die Bedeutung einer frühzeitigen Thematisierung, die bereits im Kindergarten und in der Grundschule als fester Bestandteil des Alltags verankert sein sollte. Damit wird der Grundstein für ein kritisches Verständnis von Medieninhalten gelegt. Darauf aufbauend sind Projekte der handlungsorientierten Medienarbeit wichtig, in denen Kinder und Jugendliche einen selbstwirksamen Umgang mit digitalen Medien erlernen und diese nicht nur konsumieren, sondern auch selbst gestalten können. Um eine ganzheitliche Medienkompetenzförderung zu erreichen, müssen auch die Erwachsenen im Umfeld der Heranwachsenden, insbesondere Eltern, Großeltern und pädagogische Fachkräfte, durch gezielte Beratungs- und Qualifizierungsangebote in die Lage versetzt werden, Kinder und Jugendliche wirksam zu unterstützen. Ebenso wichtig ist die Bereitstellung von leicht verständlichen und altersgerechten Informationsmaterialien, die über Risiken aufklären und Tipps für einen sicheren Umgang mit digitalen Medien geben. Die Zusammenarbeit der Landesmedienanstalten untereinander sowie mit Institutionen aus Politik, Wissenschaft und Bildung spielt dabei eine zentrale Rolle, um medienpädagogische Angebote direkt und nachhaltig in den Alltag von Kindern und Jugendlichen zu integrieren. Ergänzt wird dieses Konzept durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die breit über die Bedeutung von Medienkompetenz informiert und auf aktuelle Risiken und Chancen digitaler Medien aufmerksam macht.