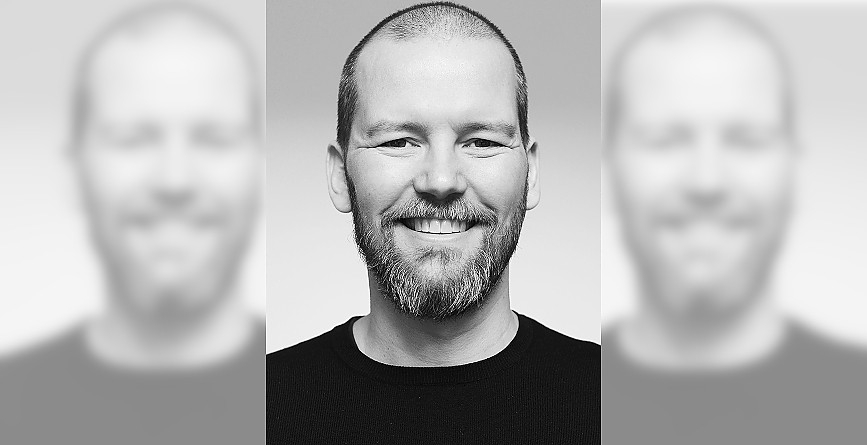Nach aktuellen Daten holen deutsche Städte bei der Digitalisierung auf. Wie smart sind die hiesigen Städte derzeit aus Ihrer Sicht im europäischen Vergleich?
Rechtliche Regelungen wie das Online-Zugang-Gesetz aber auch die Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass das Thema Digitalisierung in deutschen Städten an Fahrt aufgenommen hat. Einige andere europäische Städte waren und sind aber bei diesen Themen schon weiter, hier werden oft Barcelona, Wien oder London als Vorreiter genannt. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die Digitalisierung von Städten mit vielen Fragen verbunden ist: Wer betreibt die Infrastruktur, welcher Umgang mit Daten wird angestrebt, welche langfristigen Auswirkungen haben die heutigen Investitionen in die Digitalisierung und wie flexibel bleiben Städte, um sich auch an künftige Herausforderungen anpassen zu können? Diese Fragen müssen mit der Bevölkerung, mit Wirtschaft, Politik und Verwaltung diskutiert werden und dies erfordert Zeit. Letztlich ist diese Zeit aber gut investiert, da dadurch langfristig die Akzeptanz von Smart City Maßnahmen gestärkt werden kann. Ich sehe in vielen deutschen Städten, dass diese Diskussionen gerade geführt werden und somit eine gute Basis für die weiteren Digitalisierungsprozesse geschaffen wird.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Das Thema Cybersicherheit gilt als systemkritisch. Welche Unterstützung brauchen die Kommunen in dieser Frage?
Beim Thema Cybersicherheit ist zunächst technische Expertise gefragt. Städte bzw. städtische Einrichtungen betreiben kritische Infrastrukturen und verfügen über sensible Daten, daher erfordert es entsprechenden technischen Aufwand, um diese z.B. vor Hackerangriffen zu sichern. Aber auch rechtliche Expertise in Bezug auf Cybersicherheit ist gefragt, z.B. in Bezug auf die Verbindung von Datenschutz und Datensicherheit bei der Umsetzung der DSGVO. Und als drittes Feld ist Expertise zur Vermittlung von Themen der Cybersicherheit an die Bevölkerung nötig. Wenn wir davon ausgehen, dass die Digitalisierung in den Städten weiter voranschreitet, müssen Maßnahmen der Cybersicherheit klar kommuniziert werden, da sonst Ängste vor Smart Cities in der Bevölkerung weiterhin bestehen. In all diesen drei Feldern verfügen die Kommunen bereits über Kompetenzen, weitere Unterstützung könnte von Wissenschaft sowie von spezialisierten Beratungsunternehmen kommen.
Empfohlen werden private Finanzierungs-Partnerschaften, weil die Kooperationen mit erfahrenen Smart-City-Providern versprechen. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie in (teil-)privaten Finanzierungsmodellen für Smart-City-Projekte?
Eine Chance ist, dass die Städte von den Erfahrungen und den Technologien privater Firmen profitieren können und somit gerade in Bezug auf den Aufbau der notwendigen technischen Infrastruktur für Smart City schnell Ergebnisse erzielen können. Gleichzeitig ist in solchen Finanzierungsmodellen das Thema der Datensouveränität der Kommunen zu beachten und die Möglichkeit des Einsatzes von Open Data/Open Source Lösungen zu prüfen. Insofern ist es für Kommunen erforderlich, die Vor-und Nachteile von privaten Finanzierungs-Partnerschaften im Einzelfall abzuwägen.
Es gibt bereits Fördermöglichkeiten von der EU und der Bundesregierung. Wie sollten diese in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden?
Eine wichtige Fördermöglichkeit ist das BMI-Programm „Modellprojekte Smart Cities“. Die im neuen Koalitionsvertrag vorgesehene Erweiterung des Programms auf stadtregionale Ebene (Smart Region) und die Förderung des Wissens- und Erfahrungstransfers zwischen den einzelnen Kommunen sind aus meiner Sicht Schritte in die richtige Richtung. Auch auf EU-Ebene ist mit der Initiative von 100 klima-neutralen und smarten Städten eine interessante Fördermöglichkeit gerade angelaufen. Grundsätzlich sollten bei Förderprogrammen von Smart Cities die Ziele und deren Messung stärker in Vordergrund stehen: Was genau soll durch Smart City-Ansätze verbessert werden und mit welchen Indikatoren kann gemessen werden, ob diese Ziele erreicht wurden? Smart City ist somit nicht als stadtpolitisches Ziel zu sehen, sondern als eine Möglichkeit, Städte nachhaltiger und lebenswerter zu machen.