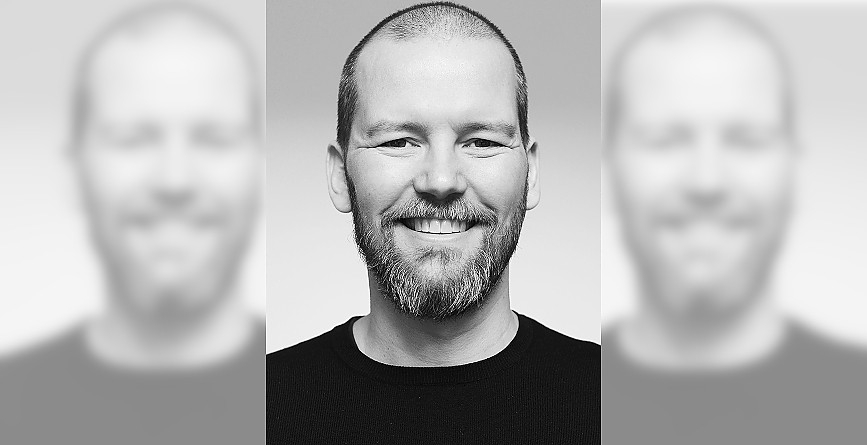Nach aktuellen Daten holen deutsche Städte bei der Digitalisierung auf. Wie smart sind die hiesigen Städte derzeit aus Ihrer Sicht im europäischen Vergleich?
Deutsche Städte werden zwar immer digitaler, nicht aber unbedingt smarter. Deutsche Städte weisen noch immer ein recht geringes Niveau an strategischer Intelligenz auf, weil sich Städte vor allem auf technische Aspekte konzentrieren, ohne die relevanten Fragen beantwortet zu haben: Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie sollen/können Mobilität, Energie, Umwelt etc. sich in der Kommune in Zukunft entwickeln? Erst wenn diese Fragen hinreichend thematisiert werden, können digitale Tools helfen, diese Ziele zu erreichen. Die in den Rankings seit Jahren führenden
Smart Cities sind bei der Beantwortung dieser Fragen Ansatz sehr viel weiter und haben schon seit langem klare Vorstellungen über die zukünftige Entwicklung. In Deutschland dagegen wird allzu häufig Innovation mit Technologie gleichgesetzt, ohne jedoch soziale, ökologische, ökonomische und eben auch langfristige Aspekte zu berücksichtigen. Wenn diese Themen zu wenig Berücksichtigung finden, wird die Digitalisierung die sozialen Unterschiede in den Gesellschaften verstärken, da sie als Katalysator für Trends fungieren, ohne explizit Lösungen anzubieten: digitale Gräben, fehlende Daten- und Privatsphäre, Kontrollverlust.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Das Thema Cybersicherheit gilt als systemkritisch. Welche Unterstützung brauchen die Kommunen in dieser Frage?
Die Digitalisierung wird zur Bedrohung, wenn Kommunen außer Acht lassen, dass die Technologisierung immense Herausforderungen mit sich bringen. Jedes technische, digitale System kann gehackt werden. Eine unbemannte Drohne mit einem Maschinengewehr auszustatten und für terroristische Angriffe zu nutzen oder ein autonom fahrendes Auto in eine Gruppe Menschen fahren zu lassen, ist problemlos möglich. Auf diese und viele weiteren Szenarien werden sich Kommunen einstellen müssen. Kommunen brauchen das Verständnis, dass Technologien immer nur Tools, Methoden sind, die helfen, Zukunft nachhaltig zu gestalten. Dafür brauchen Kommunen Unterstützung in der Gefahrenidentifizierung und -abwehr aber vor allem auch in der prospektiven Abmilderung möglicher Folgen. Und natürlich brauchen sie fachliche Expertise, in der ständigen Überwachung der eigenen technischen Systeme, um die immer auftretenden Schwachstellen in den Griff zu bekommen. Keine Kommune darf mit diesen Herausforderungen alleine gelassen werden. D.h. es braucht Organisations- und Kooperationsmodelle von allen relevanten Akteuren rund um das Thema Cybersicherheit.
Empfohlen werden private Finanzierungs-Partnerschaften, weil die Kooperationen mit erfahrenen Smart-City-Providern versprechen. Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie in (teil-)privaten Finanzierungsmodellen für Smart-City-Projekte?
Smart City-Provider sind in der Regel Firmen, die Technologien verkaufen wollen. Dies kann erst dann sinnvoll sein, wenn die strategischen Ziele der Kommune definiert sind. Dafür brauchen Kommunen eine Bewertungskompetenz für neue Technologien (welche Technologien unterstützt welches Ziel?). Trotzdem sind alternative Finanzierungsmodelle wichtig, da die finanziellen Herausforderungen für die Kommunen immens sind. Darüber hinaus empfehle ich kommunale Partnerschaften, mit erfahrenen Smart Cities aus dem Ausland, um das planerische Verständnis zu erhalten, welche Chancen und welche Risiken in einer konsequenten Umsetzung der Smart City-Strategie liegen, welche Ansätze verfolgt werden und wie die Integration aller urbanen Akteure gelingen kann.
Es gibt bereits Fördermöglichkeiten von der EU und der Bundesregierung. Wie sollten diese in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden?
Die drei letzten Moden der Stadtentwicklung lauteten: die nachhaltige Stadt, die resiliente Stadt und nun halt die smarte Stadt. Alle Moden waren und sind mit massiven Förderungen versehen. Die Erfolge sind jedoch kaum zu erkennen. Kommunen und Fördergeber brauchen das Verständnis, dass keine dieser Strategiepfade sich jemals realisieren wird, da alle als Prozess zu begreifen sind, in dem es keinen determinierten Endpunkt gibt. Es braucht somit ein Operationalisierungsansatz, um smart als Bewertungsmaßstab nutzen zu können. Denn letztlich ist es ein sehr generischer Begriff, der Städte und Regionen wenig hilft, Entscheidungen zu fällen. Es ist keine Bewertungsgrundlage, so wie es zum Beispiel die 2000-Watt-Gesellschaft in Zürich ist. Anhand dessen können Investitionen bewertet werden und daraufhin erfolgt die Entscheidung und Umsetzung.