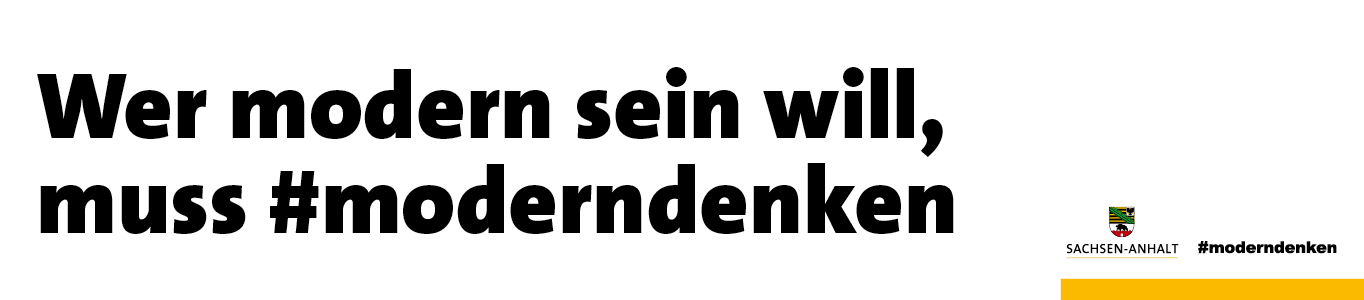Welche Auswirkungen hat der Konsum von Social-Media-Angeboten auf unser Verhalten, Familienleben und soziale Kompetenz von Heranwachsenden?
Der Konsum von Social Media Angeboten kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Social Media Angebote sind hilfreich beim Kontakthalten, der Vernetzung und dem Informationsaustausch mit Gleichaltrigen und -gesinnten und auch mit anderen Familienmitgliedern. Besonders in ländlichen Gegenden können sie zudem beim Finden von Vorbildern, die im eigenen Sozialraum nicht vorhanden sind, hilfreich sein. Sie können Räume bieten für das Ausprobieren eigener Identitäten, kreativer Kompetenzen oder auch des gesellschaftlichen Engagements. Social Media Angebote spielen eine wichtige Rolle im Leben von Kindern und Jugendlichen.
Darüber hinaus können in den Sozialen Medien Informationen recherchiert, geteilt und auch kommentiert und diskutiert werden. Sie ermöglichen also auch die politische Teilhabe/Partizipation und tragen zur politischen Meinungsbildung bei.
Gleichzeitig können diese, negative Auswirkungen haben: Unterschiedliche Vorstellungen über die Mediennutzungszeiten und-situationen können zu Konflikten innerhalb der Familien führen. Kinder und Jugendliche können Risiken wie Cybermobbing, Sexting, Cybergrooming oder Desinformation und Hate Speech ausgesetzt sein. Studien zeigen auch, dass stereotype Darstellungen von Geschlechterrollen sowie Körperidealen und Lebensmodellen die Psyche insbesondere der jugendlichen Nutzer*innen negativ beeinflussen können. Hinzu kommen Risiken wie Sucht oder Glücksspiel etc.
Wichtig ist es, Kinder und Jugendliche im Umgang mit Social Media Anwendungen zu begleiten, sie über Risiken aufzuklären und gleichzeitig deren Recht auf Privatsphäre zu berücksichtigen.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Wie kann man Kinder und Jugendliche für manipulative Funktionen bei Social-Media-Plattformen sensibilisieren?
Im ersten Schritt ist es wichtig, dass sich pädagogische Fachkräfte und Elternmit den Potenzialen, Risiken und vorhandenen Sicherheitseinstellungen der Social Media Plattformen vertraut machen. Hierzu gehört auch das Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen, welche Anwendungen sie wofür nutzen. Eltern und Fachkräfte finden hier zahlreiche Angebote von Trägern wie dem Landesfachverband Medienbildung Brandenburg (lmb e.V.) oder der Aktion Kinder und Jugendschutz Brandenburg oder auch auf Portalen wie elternguide.online, klicksafe.de oder Schau-hin.info.
Im zweiten Schritt kann gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen erkundet werden: Welche Plattformen nutzen sie? Wie geht es ihnen nach der Nutzung? Haben sie schon negative Gefühle nach der Nutzung gehabt? Welche Risiken kennen sie bereits? Oft sind Jugendlichen die Gefahren und Mechanismen bekannt und sie haben schon Strategien des Umgangs damit entwickelt.
Im dritten Schritt sollten die Probleme und Mechanismen sowie die Funktionsweise von Algorithmen aufgezeigt und mögliche Handlungsoptionen aufgezeigt werden. Hierbei sollten auch Lösungen aus dem technischen Jugendmedienschutz berücksichtigt werden.
Anregungen für kinder- und jugendgerechte Methoden zur Sensibilisierung sind auf den oben genannten Angebotsseiten zu finden.
Strategien wie Dark Patterns und Digital Nudging wurden als manipulativ entlarvt. Sollte es gesetzlich geregelte Grenzen für verhaltensbeeinflussende Mediendesigns geben?
An den Stellen, an denen Strategien wie Dark Patterns und Digital Nudging dazu dienen sollen, insbesondere die jungen Nutzer*innen zu einem Verhalten zu manipulieren, welches negative (finanzielle) Folgen oder auch ein Handeln gegen die eigenen Ideale beinhaltet (vgl. Robert Noggle 1996), so ist eine gesetzliche Regelung sinnvoll und notwendig. Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag und das Jugendschutzgesetz beispielsweise haben das Ziel, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen. Hier muss überprüft werden, ob vorhandene gesetzliche Regelungen bereits ausreichen und in der Praxis auch schon genutzt werden oder ob ggf. nachgebessert werden sollte.
Wie kann die Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen insgesamt gestärkt werden?
Medienkompetenz ermöglicht Kindern und Jugendliche die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen, daher stellt sie einen elementaren Teil von Demokratiebildung dar.
Die Digitalisierung der Gesellschaft unterliegt einem stetigen Wandel, daher ist auch die Stärkung der Medienkompetenz ein stetiger Prozess. Es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen die Potenziale, Risiken und Handlungsoptionen aufzuzeigen und sie für den Umgang damit zu befähigen. Angebote und Formate der Medienkompetenzbildung von Kindern und Jugendlichen sollten diese zu einem reflektierten, kritischen, aktiven und kreativen Umgang mit Medien und Medieninhalten befähigen. In den Lernprozessen braucht es Raum für Selbstwirksamkeitserfahrungen und Mitgestaltungsmöglichkeiten.
Schule, Jugendfreizeiteinrichtungen und Elternhaus benötigen die Bereitschaft und Kenntnisse, um die Kinder und Jugendlichen in ihren Lernprozessen kompetent zu begleiten. Hier ist zum einen die Reflexion des eigenen Medienhandelns notwendig, denn erwachsene Bezugspersonen sind Vorbilder für die Heranwachsenden. Zum anderen müssen pädagogische Fachkräfte geschult werden; auch um Eltern beraten zu können. Medienkompetenz bzw. -pädagogik muss also breitenwirksam, systematisch und nachhaltig in allen Bildungsbereichen der Gesellschaft verankert werden! (Siehe Initiative „Keine Bildung ohne Medien!“)