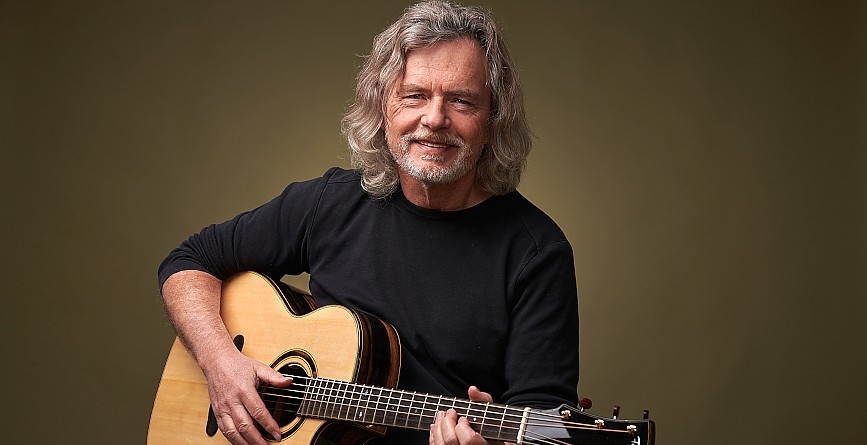Nach aktuellen Daten wenden sich junge Hörer zunehmend Online-Audio-Angeboten zu. Wie kann das lineare Radio insbesondere gegen Musik-Streaming-Dienste dauerhaft bestehen?
Zunächst müssen wir festhalten: Auch lineares Radio gibt es online – und ist damit ein Online-Audio-Angebot. Und das ist auch gut so: Denn immer mehr Menschen in Deutschland hören zumindest gelegentlich Radio über das Internet, mittlerweile mehr als jede/r zweite ab 14-Jährige (53,3 %), so der neue Online-Audio-Monitor 2021*. Weit überdurchschnittlich viele Hörerinnen und Hörer erreicht lineares Webradio unter den 14- bis 29-Jährigen, nämlich fast zwei von drei (63,1 %). Das sind anteilig ebenso viele wie bei den 30- bis 49-Jährigen (64,2 %). Der jungen Zielgruppe pauschal zu unterstellen, sie sei für lineare Medienangebote nicht mehr empfänglich, trifft also nicht zu.
Auch die unter 30-Jährigen hören am häufigsten die etablierten Simulcast-Sender, also vertraute Marken. Genau da setzen viele Radioanbieter an, um sich auch in der neuen Audiowelt einen festen Platz zu sichern: Sie bieten immer mehr Online-Submarken für alle erdenklichen Geschmäcker an. Dabei geht es – genau wie bei reinen Webradioprogrammen – nicht mehr um Masse, sondern um Klasse. Direkte Zielgruppenansprache und der Community-Gedanke sind das Bindemittel. Wenn es dann noch gelingt, das „Beste aus zwei Welten", nämlich spezielle Musik mit dem Live-Erlebnis und den Infotainment-Elementen des Radios zu verbinden, ist das ein ganz klarer Vorteil gegenüber den Musikstreaming-Diensten.
JETZT HERUNTERLADEN
DIE DOKUMENTATION DIESER FACHDEBATTE
DIE DOKUMENTATION ENTHÄLT
Übersicht aller aktiven Debattenteilnehmer
Summary für Ihr Top-Management
Beim Kern-Inhalt Musik entdeckt die junge Generation neue Trends häufig auf Plattformen wie Tik Tok. Wie kann das klassische Radio in dieser Frage seine Relevanz behaupten?
Abgesehen von einigen Nischenprogrammen, die sich auf „neue Musik" spezialisiert haben, gilt für alle Radiosender schon seit Jahren: Sie spielen mehr als Verbreiter beliebter Musik eine Rolle und weniger als Entdecker. Wer die ganz junge Zielgruppe erreichen will, ist aber sicher gut beraten, auch auf TikTok zu sein, um sie dort zu treffen, kennenzulernen und abzuholen.
Insgesamt werden sich Radio-Sender aber nicht durch ihre Musikauswahl unersetzlich machen – auch wenn Musik nach wie vor eine wichtige Rolle spielt. Der entscheidende USP, das Alleinstellungsmerkmal des Radios, ist vielmehr das Zusammenspiel von gutem Content, Live-Charakter und unverwechselbaren Personalities. Menschen hören gerne Menschen zu – das gilt auch für die junge Generation. Radio überzeugt also, auch und gerade in der Audiowelt der Zukunft, durch Persönlichkeit, Nähe, Unmittelbarkeit und Emotion.
Wie können neue Online-Formate wie etwa Online-Spartenkanäle oder Podcasts helfen, junge Zielgruppen an klassische Radio-Marken zu binden?
Der Online-Audio-Boom lässt den Audio-Markt insgesamt wachsen. Er hat nicht nur zu einer Renaissance des Hörens geführt, sondern auch zu einer Renaissance des Radios. Wenn Radio-Sender auch mit Online-Formaten präsent sind, zahlen diese neuen Angebote natürlich gleichzeitig auf die klassischen Marken ein. Wichtig ist dabei, auch online einen gewissen Community-Spirit zu schaffen, in Interaktion zu treten mit den Hörerinnen und Hörern, sie neugierig darauf zu machen, was der Anbieter sonst noch so im Portfolio hat... Alle Sender sollten daher mit neuen Online-Formaten spielen, erfahren, wie sich Radio künftig anhören könnte, wie es veränderte Publikumswünsche online und offline bedient.
Klassische Radio-Vollprogramme senden neben Musik auch Nachrichten und Informationen – wie kann und sollte die Politik helfen, dass solche Inhalte auch künftig junge Zielgruppen erreichen?
Die Politik kann und möchte Hörerinnen und Hörern natürlich nicht vorschreiben, welche Inhalte über welche Kanäle gehört werden. Sie kann aber Rahmenbedingungen schaffen, die chancengleiche Auffindbarkeit und Transparenz sicherstellen. Hier ist mit dem neuen Medienstaatsvertrag (MStV) ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gegangen worden. Die staatsfernen Medienanstalten sind beauftragt, die Einhaltung der neuen Vorgaben zu überwachen.
Die Plattformregulierung hat dabei zum Ziel, Diskriminierungsfreiheit, Chancengleichheit und Auffindbarkeit von inhaltlichen Angeboten mit Relevanz für die öffentliche Meinungsbildung sicherzustellen und somit einen fairen Wettbewerb zu sichern. So haben die Medienanstalten in ihrer konkretisierenden Plattformsatzung beispielsweise Kriterien für die Sortierung von Inhalten festgelegt – etwa die alphabetische Reihenfolge, Genres wie Information, Bildung, Kultur, Regionales oder Unterhaltung oder Nutzungsreichweite.
Darüber hinaus haben die Medienanstalten mit Inkrafttreten der Public-Value-Satzung am 1. September eine Ausschreibung gestartet: Im Rahmen dieses Verfahrens können sich private Angebote bis Ende September um den Public-Value-Status bewerben. Wer diesen Status hat, also laut MStV „für die gesellschaftliche Meinungsbildung besonders relevant" ist, muss künftig auf Benutzeroberflächen leichter auffindbar sein. Zu solchen relevanten Inhalten zählen etwa nachrichtliche Berichterstattungen, lokale oder regionale Informationen und in Europa eigenproduzierte, barrierefreie oder speziell auf eine junge Zielgruppe ausgerichtete Inhalte. Bis zum Frühjahr soll entschieden sein, welche Angebote diesen Status bekommen.
* siehe: www.online-audio-monitor.de