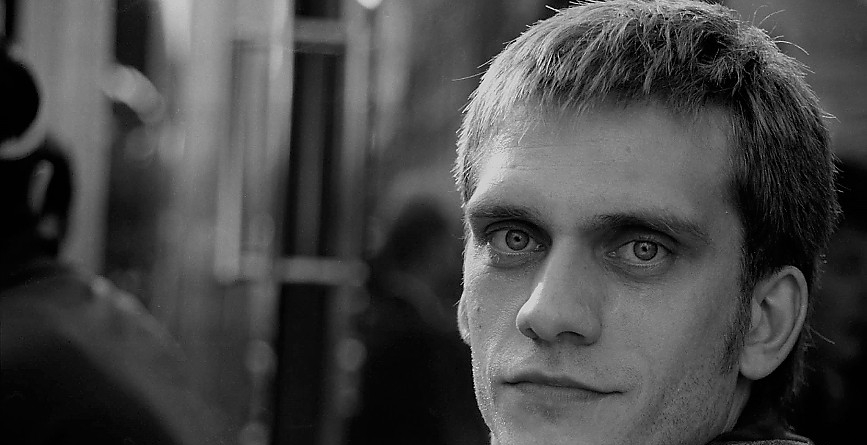Immer mehr Spiel- und Lerntools auf digitalen Endgeräten (bsw. Audio-/Bewegtbildformate auf Smartphones) erobern das Kinder- und Jugendzimmer. Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für den Jugendmedienschutz?
Tools auf digitalen Endgeräten bieten Kindern und Jugendlichen tolle Möglichkeiten, spielerisch die Welt zu entdecken und Neues zu lernen. Für den Jugendmedienschutz ergibt sich die Herausforderung, sie dabei vor den gleichen Gefahren zu schützen, die es auch in der „Offline“-Welt gibt – beispielsweise Gewalt, Missbrauch, Extremismus oder Verleitung zu Selbstverletzung. Um diesen Schutz zu gewährleisten, muss an drei Stellen angesetzt werden: Erstens bedarf es struktureller Vorkehrungen, die Kinder und Jugendliche vor der (ungewollten) Konfrontation mit ungeeigneten Angeboten schützen. Hier sind vor allem die Anbieter in der Pflicht: Schon bei der Entwicklung von Angeboten – egal ob Software oder Hardware – muss der Jugendschutz mitgedacht und umgesetzt werden. Zu solch einem „Jugendschutz by design“ gehören zum Beispiel klare Alterskennzeichnungen oder die Einrichtung verlässlicher Zugangsbarrieren für Angebote, die für bestimmte Altersgruppen ungeeignet sind. Zweitens müssen vor allem jüngere Kinder bei ihrer Mediennutzung begleitet werden. Auch wenn es gerade bei mobilen Endgeräten nicht immer einfach zu realisieren ist: Eltern und Pädagogen sollten wissen, wo die Kinder und Jugendlichen online unterwegs sind, sie über mögliche Gefahren aufklären und das Gespräch suchen, wenn problematische Angebote rezipiert wurden. Und drittens muss der Umgang mit den potenziellen Gefahren natürlich ganz klar reguliert sein. Aufsichtsorgane wie die Kommission für Jugendmedienschutz müssen Anbietern, die das geltende Recht missachten, deutliche Grenzen setzen und die Verstöße ahnden. Um dies zu gewährleisten, muss aber auch der Gesetzgeber die geltenden Rechtsgrundlagen immer wieder überprüfen und anpassen, um eine effektive Regulierung auch im Kontext neuer technologischer Entwicklungen zu ermöglichen. Und selbstverständlich stellt gerade bei Onlineangeboten auch die grenzüberschreitende Nutzung eine große Herausforderung dar: Für einen effektiven Jugendmedienschutz sind gemeinsame Anstrengungen aller Akteure auf internationaler Ebene unabdingbar.
Wie können Verbraucher gute von nicht empfehlenswerten Angeboten unterscheiden?
Eine gute Richtschnur ist grundsätzlich die Alterskennzeichnung, die auch in vielen App-Stores angezeigt werden. Da aber leider nicht alle Spiel- oder Lerntools eine solche Kennzeichnung haben, helfen Beratungsangebote weiter: Der Verein Internet-ABC, dem alle Landesmedienanstalten Deutschlands angehören, listet auf seiner Webseite internet-abc.de hunderte Spiele und Lernangebote, die für Kinder und Jugendliche empfehlenswert sind. Auch auf der von jugendschutz.net angebotenen Internetseite app-geprüft.net finden Eltern und Erziehungsverantwortliche hilfreiche Infos zu den meistgenutzten und beliebtesten Spiele-Apps.
Außerdem können gerade jüngere Kinder Suchmaschinen wie Blinde Kuh oder Frag Finn nutzen, die in ihren Ergebnissen nur Onlineangebote anzeigen, die von medienpädagogisch geschulten Redakteuren geprüft und für Kinder als unbedenklich beurteilt worden sind. Große Aufmerksamkeit der Nutzer ist generell in Daten- und Verbraucherschutzfragen geboten: Bei vielen Apps gibt es hier leider deutlichen Nachholbedarf in Sachen Transparenz und Sicherheit.
Welche Herausforderungen stellen digitale Spielformen an die Medienkompetenzentwicklung von Kindern und Jugendlichen?
Apps auf mobilen Endgeräten ermöglichen bereits Kindern im Vorschulalter einen niedrigschwelligen Zugang zu digitalen Spielen. Dies stellt die Medienkompetenz vor große Herausforderungen, denn gerade die Jüngsten sind am wenigsten in der Lage, mit problematischen Inhalten umzugehen. Deshalb raten wir Eltern von jüngeren Kindern, dass sie diese bei ihren ersten Schritten in der digitalen Welt stets begleiten, sich mit ihnen über das gemeinsam Erlebte austauschen und Regeln zur Nutzungsdauer vereinbaren.
Mit zunehmendem Alter und dem Erwerb der Lesekompetenz kommen zu den Konfrontationsrisiken durch problematische Inhalte auch noch mögliche Kontaktrisiken wie Cyber-Grooming, also die sexuelle Belästigung oder das Anbahnen sexueller Kontakte durch die Nutzung von in Spielen integrierten Chats und Kommunikationsdiensten, hinzu. Weiterhin gilt es, Kinder und Jugendliche auf Kostenfallen durch In-App-Käufe oder In-App-Werbung aufmerksam zu machen. Diese vielfältigen Herausforderungen an die Medienkompetenzentwicklung müssen sowohl von Eltern, als auch von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen in Angriff genommen werden, um Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten, kompetenten und mündigen Mediennutzung zu unterstützen. Die Landesmedienanstalten leisten auch hier einen wichtigen Beitrag, z. B. durch zahlreiche Informationsmaterialien sowie Medienkompetenzangebote an Schulen, Kindergärten und außerschulischen Einrichtungen. Denn über den richtigen Einsatz digitaler Spielformen lassen sich neben der Medienkompetenz auch weitere Schlüsselkompetenzen steigern.
Wie können die Medienanstalten Selbstregulierung und Selbstverantwortung der Hersteller fördern?
Die Kommission für Jugendmedienschutz beaufsichtigt – neben dem privaten Rundfunk – die Telemedien, also auch Onlineangebote. Diese Aufsicht übt sie als Organ der Landesmedienanstalten aus. Sie prüft mögliche Verstöße gegen die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages und beschließt entsprechende Maßnahmen, die die Landesmedienanstalten vollziehen. Abgesehen von diesem repressiven Jugendmedienschutz, der den Anbietern die Grenzen ihres Handelns und ihre Verantwortung für den Jugendschutz aufzeigt, fördert die KJM aber auch die regulierte Selbstregulierung: Sie erkennt Einrichtungen der freiwilligen Selbstkontrolle an, die die Eigenverantwortung der Internetanbieter stärken. Für die Landesmedienanstalten überprüft die KJM, ob sich die Entscheidungen der Selbstkontrolleinrichtungen im Rahmen des rechtlichen Beurteilungsspielraums bewegen und steht mit ihnen in regelmäßigem Austausch. Darüber hinaus fördern die KJM und die Landesmedienanstalten den öffentlichen Diskurs – z. B. im Rahmen von Fachveranstaltungen – oder wissenschaftliche Beiträge zum Thema. Aktuell wird im Auftrag der KJM an der Hochschule für Medien Stuttgart ein Gutachten zu direkten Kaufappellen an Kinder und Jugendliche in sozialen Medien erstellt, das Mitte des Jahres veröffentlicht werden soll.
ÜBER UNS
Meinungsbarometer.info ist die Plattform für Fachdebatten in der digitalen Welt. Unsere Fachdebatten vernetzen Meinungen, Wissen & Köpfe und richten sich an Entscheider auf allen Fach- und Führungsebenen. Unsere Fachdebatten vereinen die hellsten Köpfe, die sich in herausragender Weise mit den drängendsten Fragen unserer Zeit auseinandersetzen.
überparteilich, branchenübergreifend, interdisziplinär
Unsere Fachdebatten fördern Wissensaustausch, Meinungsbildung sowie Entscheidungsfindung in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Gesellschaft. Sie stehen für neue Erkenntnisse aus unterschiedlichen Perspektiven. Mit unseren Fachdebatten wollen wir den respektvollen Austausch von Argumenten auf Augenhöhe ermöglichen - faktenbasiert, in gegenseitiger Wertschätzung und ohne Ausklammerung kontroverser Meinungen.
kompetent, konstruktiv, reichweitenstark
Bei uns debattieren Spitzenpolitiker aus ganz Europa, Führungskräfte der Wirtschaft, namhafte Wissenschaftler, Top-Entscheider der Medienbranche, Vordenker aus allen gesellschaftlichen Bereichen sowie internationale und nationale Fachjournalisten. Wir haben bereits mehr als 600 Fachdebatten mit über 20 Millionen Teilnahmen online abgewickelt.
nachhaltig und budgetschonend
Mit unseren Fachdebatten setzen wir auf Nachhaltigkeit. Unsere Fachdebatten schonen nicht nur Umwelt und Klima, sondern auch das eigene Budget. Sie helfen, aufwendige Veranstaltungen und überflüssige Geschäftsreisen zu reduzieren – und trotzdem die angestrebten Kommunikationsziele zu erreichen.
mehr als nur ein Tweet
Unsere Fachdebatten sind mehr als nur ein flüchtiger Tweet, ein oberflächlicher Post oder ein eifriger Klick auf den Gefällt-mir-Button. Im Zeitalter von X (ehemals Twitter), Facebook & Co. und der zunehmenden Verkürzung, Verkümmerung und Verrohung von Sprache wollen wir ein Zeichen setzen für die Entwicklung einer neuen Debattenkultur im Internet. Wir wollen das gesamte Potential von Sprache nutzen, verständlich und respektvoll miteinander zu kommunizieren.